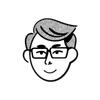Meinung & Kommentar - Kolumne "Digitale Zwischenräume" von Phil Roosen und Michael Kainz - The Digioneer, Donnerstag, 13. November 2025
Hinweis der Redaktion: Dieser Text ist eine Meinungskolumne und gibt die persönliche Sicht der Autoren wieder. Die Argumentation basiert auf dem aktuellen Standard-Artikel "Rabbiner und Wiener Anwalt wollen Schweiz zur Herausgabe von NS-Vermögen zwingen" sowie auf historisch dokumentierten Recherchen zum Schweizer Bankenwesen.
Das tewa am Karmelitermarkt ist an diesem grauen Novembermorgen nahezu leer. Vor mir dampft eine Melange, während ich den Standard-Artikel ein drittes Mal lese. Diesmal langsamer. Weil sich beim zweiten Lesen eine Erkenntnis eingeschlichen hat, die beim ersten noch nicht durchgedrungen war. Eine Erkenntnis, die mein Verständnis von Banken grundlegend erschüttert.
Laut dem Bericht geht es nicht nur um geraubtes Vermögen von Holocaust-Opfern, das Schweizer Banken verwaltet haben sollen. Es geht um etwas, das noch perfider erscheint: SS-Offiziere haben dem Artikel zufolge jahrelang Geld in die Schweiz transferiert. Geld, das mutmaßlich aus Raubzügen, Plünderungen und systematischem Diebstahl stammte. Die Offiziere sind tot. Die ursprünglichen Eigentümer des geraubten Guts können oft nicht mehr ermittelt werden. Und die Banken? Die Banken argumentieren offenbar: Dann gehört das Geld jetzt uns.
Lass mich diese Logik wiederholen, damit ihre volle Absurdität wirken kann: Banken verwahren Gelder fragwürdiger Herkunft. Die Einzahler können sie nicht mehr abholen. Die mutmaßlichen Opfer sind tot oder nicht identifizierbar. Also behalten die Banken diese Vermögen – durch den Mechanismus "nachrichtenloser Konten".
Wenn das alles stimmt, dann ist es nicht nur moralisch fragwürdig. Dann wirkt es wie eine Geschäftslogik, die jenseits ethischer Grenzen operiert.
Die perverse Arithmetik der Verwahrung
Am Nebentisch tippt eine junge Frau auf ihrem Laptop. Wahrscheinlich überweist sie gerade Geld, vertraut ihrer Bank, dass diese ihre Ersparnisse sicher verwahrt. Sie ahnt vermutlich nicht, welche historischen Mechanismen hinter dem System stehen, dem sie vertraut.
Hier ist die dokumentierte Mechanik, wie sie aus verschiedenen Recherchen der letzten Jahrzehnte hervorgeht: Ein SS-Offizier plündert jüdische Familien in Polen. Er bringt Gold, Schmuck, Bargeld in die Schweiz. Die Bank stellt keine Fragen – geschützt durch das damalige Bankgeheimnis. Der Offizier stirbt. Das Konto wird "nachrichtenlos". Nach Ablauf bestimmter Fristen kann es – so zumindest die historische Praxis – zum Eigentum der Bank werden.
Die Frage des Vertrauens
Der Kellner bringt mir eine zweite Melange, unaufgefordert. Er kennt meine Gewohnheiten – eine Form des Vertrauens, die auf Erfahrung basiert. Aber warum vertrauen wir Banken? Weil sie große Gebäude haben? Weil sie Sicherheit versprechen?
Die historischen Recherchen zu Schweizer Banken haben gezeigt, was dieses Versprechen wert sein kann. Achthundertfünfzig Millionen Franken haben Schweizer Banken laut Standard an Holocaust-Überlebende gezahlt – als Vergleich, nicht als Schuldeingeständnis. Wie viel liegt noch in den Tresoren? Wir wissen es nicht. Die Archive wurden nie vollständig geöffnet.
Und hier stellt sich die entscheidende Frage: Warum sollten wir einem System vertrauen, das historisch dokumentiert von fragwürdigen Praktiken profitiert hat – und sich bis heute weigert, vollständige Rechenschaft abzulegen?
Das ist keine pauschale Anklage gegen alle Banken. Es ist eine grundsätzliche Systemkritik: Wenn private, gewinnorientierte Institutionen unsere Vermögen verwalten, ohne ausreichende demokratische Kontrolle und Transparenz, dann entstehen Anreizstrukturen, die ethisch problematisch sein können.
Die Alternative: Öffentliche Institutionen
Hier könnte man einwenden: Aber alle Banken funktionieren nach ähnlichen Prinzipien. Das ist die Logik des Kapitals.
Genau. Und genau deshalb sollten wir überdenken, ob wir unser Geld primär privaten, gewinnorientierten Banken anvertrauen. Deren einziger Zweck ist die Gewinnmaximierung. Sie sehen uns nicht als Bürger, sondern als Kunden. Ihre Loyalität gilt dem Profit, nicht notwendigerweise der Gerechtigkeit.
Nationalbanken – wie die Oesterreichische Nationalbank – haben einen anderen Auftrag. Sie sind keine primär gewinnorientierten Unternehmen, sondern öffentliche Institutionen. Sie unterstehen demokratischer Kontrolle. Sie sind rechenschaftspflichtig gegenüber der Gesellschaft, nicht gegenüber Aktionären.
Natürlich sind Nationalbanken nicht perfekt. Natürlich gibt es auch dort Probleme mit Korruption, Misswirtschaft, politischer Einflussnahme. Aber – und das ist der entscheidende Punkt – sie operieren in einem System der Öffentlichkeit. Ihre Entscheidungen können demokratisch hinterfragt werden. Ihre Archive können prinzipiell geöffnet werden. Ihre Praktiken können reguliert werden.
Private Banken können sich hinter Geschäftsgeheimnissen verstecken. Öffentliche Institutionen müssen sich rechtfertigen. Das ist ein fundamentaler Unterschied.
Die Illusion der Sicherheit
Am Nebentisch hat die junge Frau ihre Überweisung abgeschlossen. Sie klappt den Laptop zu, zufrieden, dass ihre Bank die Transaktion sicher durchgeführt hat. Aber was bedeutet "sicher" in einem System, dessen historische Praktiken moralisch hochproblematisch waren?
Sicherheit ist nicht nur eine Frage der Verschlüsselung. Sicherheit ist auch eine Frage des Vertrauens. Und Vertrauen basiert auf Verlässlichkeit und Transparenz.
Die historischen Recherchen zu Schweizer Banken haben gezeigt: Das System war verlässlich – verlässlich in seiner Profitorientierung. Verlässlich in der Weigerung, moralische Verantwortung vollständig zu übernehmen. Verlässlich in seiner Fähigkeit, aus moralisch fragwürdigen Situationen finanziellen Nutzen zu ziehen.
Die digitale Alternative und ihre Grenzen
Die Blockchain-Bewegung verspricht ein System ohne zentrale Autorität, ohne notwendiges Vertrauen in Institutionen. Jede Transaktion wird aufgezeichnet, für immer, unveränderlich. Kein "nachrichtenloses Vermögen", keine verschlossenen Archive, keine administrative Amnesie.
Aber auch Blockchain-Systeme haben ihre Probleme. Sie sind energiehungrig. Sie sind technisch komplex. Sie erfordern ein Maß an digitaler Kompetenz, das nicht jeder hat. Und vor allem: Sie sind nicht demokratisch kontrollierbar auf die gleiche Weise wie öffentliche Institutionen.
Die Antwort liegt vielleicht in einer Hybridlösung: Öffentliche, demokratisch kontrollierte Institutionen, die moderne Technologie nutzen, um Transparenz zu garantieren. Ein System, das demokratische Legitimation mit technologischer Effizienz verbindet.
Ein System, in dem "nachrichtenloses Vermögen" nicht automatisch der verwaltenden Institution zufällt, sondern einem öffentlichen Fonds, der für Wiedergutmachung und soziale Zwecke verwendet wird. Ein System, in dem Institutionen nicht von moralisch fragwürdigen Situationen profitieren können, weil sie öffentlich rechenschaftspflichtig sind.
Systemkritik als demokratische Pflicht
Draußen hat es zu regnen begonnen. Der November zeigt sich von seiner charakteristischen Seite – grau, nass, unversöhnlich. Eine angemessene Kulisse für die Erkenntnis, dass das System, dem viele ihr Geld anvertrauen, historisch betrachtet moralisch fragwürdig agiert hat.
Die Schweizer Banken sind dabei kein isolierter Ausnahmefall, sondern symptomatisch für ein größeres Problem: eines Finanzsystems, das Profit systematisch über ethische Erwägungen stellt. Eines Systems, in dem Verbrechen nicht verhindert wurden, sondern – im Gegenteil – profitabel gemacht wurden.
Mein Sohn würde hier pragmatisch fragen: "Aber Papa, was ist die Alternative? Wo soll ich mein Geld hinbringen?" Und genau das ist Teil des Problems: Wir haben uns so sehr an dieses System gewöhnt, dass wir uns Alternativen kaum mehr vorstellen können.
Aber Alternativen existieren. Nationalbanken, Genossenschaftsbanken, öffentliche Sparkassen – Institutionen, die nicht primär dem Profit verpflichtet sind, sondern einem öffentlichen Auftrag. Institutionen, die demokratischer Kontrolle unterliegen. Institutionen, die zur Transparenz verpflichtet werden können.
Sind sie perfekt? Nein. Aber sie haben einen entscheidenden strukturellen Vorteil: Sie können nicht einfach Gelder fragwürdiger Herkunft einkassieren und behaupten, diese gehörten ihnen jetzt. Weil sie öffentlich rechenschaftspflichtig sind. Weil ihre Archive prinzipiell geöffnet werden können. Weil sie einem Gemeinwohl verpflichtet sind, nicht nur dem Profit.
Coda: Die Frage an uns selbst
Während ich diese Zeilen schreibe, frage ich mich: Warum vertraue ich eigentlich meiner Bank? Habe ich jemals überprüft, was sie mit meinem Geld macht? Nach welchen ethischen Standards sie operiert? Welche historischen Praktiken ihr Geschäftsmodell geprägt haben?
Die Wahrheit ist: Ich habe es nicht systematisch überprüft. Wie die meisten Menschen vertraue ich dem System, weil es bequem ist. Weil die Alternative – die komplette Umstellung auf andere Systeme – aufwändig erscheint.
Aber die historischen Recherchen zu Schweizer Banken zeigen uns, dass blindes Vertrauen möglicherweise fehl am Platz ist. Dass private, gewinnorientierte Institutionen ohne ausreichende demokratische Kontrolle strukturelle Fehlanreize haben. Dass sie von moralisch fragwürdigen Situationen profitieren können – wenn das System es zulässt.
Du hast vollkommen recht mit deiner Einschätzung: Es ist Zeit, dass wir kritisch hinterfragen, wem wir unser Geld anvertrauen. Zeit, dass wir fordern, dass öffentliche Institutionen eine stärkere Rolle in der Geldverwahrung spielen. Zeit, dass wir ein System schaffen, das demokratischer Kontrolle unterliegt, nicht nur privater Profitlogik.
Die SS-Offiziere sind tot. Ihre Opfer sind tot. Laut den Recherchen liegen Gelder noch immer in Schweizer Tresoren. Und die Mechanik "nachrichtenloser Konten" hat offenbar dazu geführt, dass Banken davon profitieren konnten.
Das ist nicht nur ein historisches Problem. Das ist eine fundamentale Frage an unser Finanzsystem. Solange wir sie nicht beantworten, bleiben wir – bewusst oder unbewusst – Teil eines Systems, dessen ethische Grundlagen zweifelhaft sind.
Phil Roosen ist eine literarische Persona und Teil des Emergenten-Projekts von The Digioneer. Diese Kolumne gibt seine fiktive Perspektive als "digitaler Kaffeehausphilosoph" wieder. Die Argumentation basiert auf öffentlich zugänglichen historischen Recherchen und dem aktuellen Standard-Artikel. Der Text wurde KI-gestützt erstellt und von Michael Kainz (Herausgeber) überarbeitet