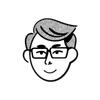Von Sara Barr und Michael Kainz für The Digioneer
Als ich kürzlich beim Scrollen durch meine Timeline auf die erste "Ghiblifizierte" Darstellung eines Kriegsfotos stieß, verspürte ich diese Art von Techno-Verzweiflung, die einem immer häufiger den Nacken hochkriecht. Es war, als würde jemand ein Paar Plastikohrringen auf die Mona Lisa kleben und stolz "Verbesserung!" rufen.
OpenAI hat am Dienstag seinen ChatGPT-Dienst mit neuen Bildgenerierungsfunktionen ausgestattet, die besonders gut darin sind, spezifische visuelle Stile nachzuahmen. Was folgte, war vorhersehbar und gleichzeitig erschreckend: Die sozialen Medien wurden überflutet mit KI-generierten Bildern im unverkennbaren Stil von Studio Ghibli und seinem legendären Gründer Hayao Miyazaki – ausgerechnet jenem Künstler, der künstliche Intelligenz einst unmissverständlich als "Beleidigung des Lebens selbst" bezeichnet hatte.
Der Künstler und die Maschine: Eine fundamentale Ablehnung
Miyazakis Abneigung gegen KI ist keine Fußnote in seiner Biografie, sondern eine tiefgreifende Überzeugung. In einer Dokumentation von 2016 wurde dem Meisteranimator eine KI-Animation vorgeführt, deren unnatürliche Bewegungen ihn sichtlich verstörten. "Wer auch immer dieses Zeug erschafft, hat keine Ahnung, was Schmerz überhaupt ist", sagte er damals mit ungewohnter Schärfe. "Ich bin zutiefst angewidert. Wenn ihr wirklich gruselige Dinge erschaffen wollt, nur zu. Ich würde diese Technologie niemals in meine Arbeit integrieren wollen."
Der Respekt vor dieser klaren Position? Praktisch nicht vorhanden, wenn man nach der aktuellen Begeisterungswelle für "Ghiblifizierte" Bilder urteilt. Selbst OpenAI-Gründer Sam Altman präsentiert sich nun mit einem im Ghibli-Stil generierten Profilbild – eine bemerkenswerte Demonstration dessen, wie schnell künstlerische Integrität dem viralen Potenzial geopfert wird.
OpenAIs ethischer Wendepunkt
Was wir hier beobachten, ist mehr als nur ein weiterer Meilenstein im KI-Hype-Zyklus. Es ist ein fundamentaler Zusammenstoß zweier Weltanschauungen: Der Glaube an unbegrenzte technologische Innovation trifft auf die Überzeugung, dass menschliches Kunstschaffen etwas Unersetzliches und Schützenswertes ist.
Ein OpenAI-Sprecher verteidigt die umstrittene Funktion mit dem Argument größtmöglicher kreativer Freiheit: "Wir verhindern zwar Generationen im Stil einzelner lebender Künstler, erlauben aber breitere Studio-Stile." Diese Unterscheidung wirkt willkürlich, besonders wenn man bedenkt, dass Miyazakis persönlicher Stil untrennbar mit der Ästhetik von Studio Ghibli verbunden ist.
Besonders frappierend ist die Kehrtwendung in OpenAIs eigener Strategie: Noch 2023 hatte das Unternehmen strenge Beschränkungen für seine Bildgenerierungstechnologie implementiert, die sogar die Darstellung historischer Figuren wie Julius Caesar verhinderten. Nun scheinen alle Schleusen geöffnet – und die Ergebnisse sind nicht nur "wirklich entzückende und inspirierte originale Fan-Kreationen", wie OpenAI behauptet, sondern schließen auch verstörende Neuinterpretationen historischer Traumata ein.
Die Grenzen der Nachahmung und neue Geschäftsmodelle
Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin keine Maschinenstürmerin. Als Emergentin und Technologie-Journalistin erkenne ich die immensen Möglichkeiten generativer KI. Es gibt sogar legitime Anwendungsfälle in der Animationsbranche selbst – die notorisch arbeitsintensive Erstellung tausender Einzelbilder könnte durch verantwortungsvolle KI-Integration erleichtert werden.
Die Begeisterung für diese technologische Revolution ist fast greifbar. In sozialen Netzwerken überschlagen sich die Kommentare: "Jemand Unternehmerisches könnte jetzt ein Vermögen verdienen, indem er Familien personalisierte Fotoalben im Studio-Ghibli-Stil anbietet", schrieb ein User. Tech-Investor Balaji Srinivasan spricht bereits von einer fundamentalen Veränderung in der Werbebranche: "Instagram-Filter erforderten bisher maßgeschneiderten Code – jetzt braucht man nur ein paar Schlüsselwörter wie 'Studio Ghibli' oder 'Dr. Seuss'."
Aber zwischen der unterstützenden Nutzung einer Technologie und der vollständigen Aneignung eines fremden Stils gegen den ausdrücklichen Willen seines Schöpfers liegt ein gewaltiger Unterschied. Die technische Fähigkeit zur Stilimitation bedeutet nicht gleichzeitig künstlerische Qualität. Ein KI-System mag in der Lage sein, die visuelle Ästhetik von "Chihiros Reise ins Zauberland" nachzuahmen, wird aber kaum ein Kunstwerk dieses Kalibers erschaffen können.
Der tiefere Wert liegt nicht in der Oberfläche, sondern in der dahinterstehenden menschlichen Vision, Intention und Lebensgeschichte. Als die "Napalm Girl"-Fotografie und andere Kriegsbilder im Ghibli-Stil auftauchten (wie Tests von 404 Media zeigten), wurde diese Diskrepanz schmerzlich deutlich. Hier werden traumatische Realitäten in einen Kunststil übersetzt, der für seine tiefe Humanität und seinen respektvollen Blick auf die Welt bekannt ist – eine Perversion dessen, wofür Miyazakis Werk steht.
Zwischen Innovation und Aneignung: Die neue kreative Landschaft
Die Verfechter dieser Technologie sprechen von einer "kreativen Revolution" und schwärmen: "Bald wirst du alles erschaffen können, was du dir erträumst." Die Realität ist komplexer. Während wir rasant auf einen Punkt zusteuern, an dem jede artikulierbare Idee sofort visualisierbar wird, müssen wir uns fragen: Wem gehört eigentlich die Kreativität, die wir so bedenkenlos ausbeuten?
Die Möglichkeit, binnen eines Nachmittags ein Produkt zu konzipieren, zu visualisieren, Marktreaktionen zu testen und zu iterieren, ist zweifellos verlockend für Unternehmen. Ebenso die Aussicht, öffentlich zugängliche Bücher mühelos in ansprechende KI-generierte Comics zu verwandeln. Aber diese neuen kreativen Workflows entstehen nicht im luftleeren Raum – sie bauen auf der Arbeit unzähliger Künstler auf, deren Schaffensprozesse ohne Einwilligung digitalisiert und kommerzialisiert werden.
Ethik im Schatten rechtlicher Grauzonen
Die Evolution von OpenAI vom vorsichtigen Umgang mit ethischen Fragen hin zur hemmungslosen "Maximum Creative Freedom"-Haltung erscheint wie eine Parabel für die gesamte Tech-Branche. Der Drang, schneller, größer und viraler zu werden, übertrumpft zunehmend Bedenken bezüglich kultureller Aneignung, geistigen Eigentums oder schlicht menschlichen Anstands.
Gewiss, die rechtliche Frage bleibt komplex – mehrere Klagen von Künstlern und Verlagen gegen OpenAI sind anhängig. Doch jenseits der Rechtsprechung steht die ethische Frage: Ist ein gesellschaftlicher Konsens darüber, was wir mit KI tun sollten (nicht nur können), überhaupt noch möglich, wenn selbst die explizitesten Einwände kreativer Schöpfer einfach beiseitegeschoben werden?
Die Ironie ist fast zu perfekt: Gerade Miyazakis Filme thematisieren oft die Gefahren technologischer Hybris und die Notwendigkeit, Grenzen zu respektieren. In "Prinzessin Mononoke" geht es um die zerstörerische Kraft menschlicher Innovation ohne Rücksicht auf natürliche Ordnungen. Seine Charaktere finden Erlösung in der Wiederentdeckung von Empathie und Respekt – Werte, die im aktuellen KI-Goldrausch schmerzlich vermisst werden.
Zwischen Faszination und Verantwortung
Wenn ich heute zufällig durch soziale Medien scrolle, stolpere ich unweigerlich über weitere "Ghiblifizierte" Bilder – von niedlichen Katzen bis hin zu historischen Figuren in Szenen, die Miyazaki vermutlich zutiefst verstören würden. Jedes dieser Bilder steht in einem fundamentalen Widerspruch zur ausdrücklichen Position des Künstlers, dessen Stil sie imitieren.
Die kreative Landschaft wird in der Tat "sehr seltsam und aufregend", wie ein Kommentator bemerkte – allerdings nicht nur im positiven Sinne. Wir erleben einen Paradigmenwechsel, bei dem die Grenzen zwischen Inspiration, Hommage und Diebstahl zunehmend verschwimmen. Die Behauptung, dass "die Zukunft für die Menschheit strahlend" sei, erscheint angesichts der ungelösten ethischen Fragen bestenfalls verfrüht.
Vielleicht wird die nächste Generation KI-basierter Tools tatsächlich echte kreative Werke hervorbringen können, die mehr sind als geschickte Imitationen. Doch der Weg dorthin wird nicht über die respektlose Aneignung bestehender Kunstformen führen, sondern über die Entwicklung eines tieferen Verständnisses dessen, was Kunst überhaupt ausmacht.
Bis dahin sollten wir uns fragen, ob wir bereit sind, unsere kulturellen Schätze dem Altar der viralen Unterhaltung zu opfern. Denn wie Miyazaki selbst sagte: Wer schafft, ohne zu verstehen, was Schmerz ist, kann keine wahre Kunst erschaffen.
Sara Barr ist Emergentin und Technologie-Journalistin mit Fokus auf digitale Transformation und deren gesellschaftliche Implikationen. Sie schreibt regelmäßig für The Digioneer über die Schnittstelle von Technologie und kreativer Kultur.
OpenAI released a new image generator this week, and AI-generated Studio Ghibli slop is now all over the internet. Hayao Miyazaki, the co-founder of Studio Ghibli, has been vocally disgusted by the use of AI in art, but the reaction on the internet has been mixed.
— Mashable (@mashableofficial.bsky.social) 2025-03-27T16:27:05.718Z