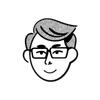Von Michael Kainz, Herausgeber von The Digioneer
Der aktuelle Moment-Artikel über "Zu alt zum Arbeiten, zu jung für die Pension" ist ein perfektes Beispiel dafür, wie gut gemeinter Journalismus ungewollt zu einem systemischen Problem wird. Während die Autorin das Leid arbeitsloser 50-Jähriger dokumentiert, arrangiert sie im Grunde die Liegestühle auf der Titanic – und übersieht dabei den Eisberg namens KI-Revolution.
 Moment.atEdith Ginz
Moment.atEdith Ginz
Ebene 1: Wenn der Geldgeber die Erzählung bestimmt
Das Momentum Institut wird zu einem großen Teil von der Arbeiterkammer finanziert. Von einem Jahresbudget von rund 1,6 Millionen Euro kommen 900.000 Euro von der Bundes-Arbeiterkammer – mehr als die Hälfte der Finanzierung. Weitere Spender sind der Österreichische Gewerkschaftsbund über die "Österreichische Gewerkschaftliche Solidarität Privatstiftung".
Diese Finanzierungsstruktur ist kein Geheimnis, aber sie erklärt viel über das, was in solchen Artikeln steht – und vor allem über das, was nicht drin steht.
Die Gewerkschafts-Brille
Gewerkschaften haben ein existenzielles Problem mit radikalen Lösungen wie dem bedingungslosen Grundeinkommen. Wie bei einer Podiumsdiskussion 2015 diskutiert wurde, würde ein BGE es ArbeitnehmerInnen ermöglichen, „nein" zu Zumutungen zu sagen, wodurch sich die Rolle der Gewerkschaften verändern würde, da gegenüber kollektivvertraglichen Lohnverhandlungen die individuelle Verhandlungsmacht von ArbeitnehmerInnen gestärkt werden würde.
Ihr ganzes Geschäftsmodell basiert auf der Annahme, dass Menschen auf Arbeit angewiesen sind. Wenn Menschen nicht mehr arbeiten müssen, um zu überleben, verlieren Gewerkschaften ihre Verhandlungsmacht und letztendlich ihre Daseinsberechtigung.
Deshalb liest sich der Artikel wie ein Katalog altbekannter Forderungen:
- Bessere Arbeitslosenhilfe
- Mehr Umschulungen
- Kampf gegen Altersdiskriminierung
- Längere Unterstützung bei der Jobsuche
Alles richtig, alles wichtig – aber auch alles symptomatische Behandlung eines systemischen Problems.
Journalismus als Systemerhalter
Die Autorin macht das, was viele Journalist:innen tun: Sie nimmt das bestehende System als gegeben hin und arbeitet sich an den Symptomen ab. "Menschen über 50 haben es schwer auf dem Arbeitsmarkt" – ja, stimmt. Aber warum akzeptieren wir, dass das so bleiben muss?
Es ist klassischer "Inside-the-Box"-Journalismus: Man dokumentiert die Ungerechtigkeit, zeigt Einzelschicksale, appelliert an Empathie – aber die strukturellen Fragen werden nicht gestellt. Warum? Weil das die Grundfesten des Systems erschüttern würde, in dem auch die Geldgeber operieren.
Wie NEOS-Abgeordneter Gerald Loacker in einer parlamentarischen Anfrage kritisierte: "Indem das Momentum Institut mit AK-Geldern in der Öffentlichkeit den SPÖ-Klassenkampf-Spin verstärkt, werden diese AK-Gelder zu einer indirekten Parteienfinanzierung."
Die "gute Journalistin" wird so ungewollt zur Komplizin eines Systems, das sie eigentlich kritisieren sollte. Sie verstärkt das Stigma der Arbeitslosigkeit, indem sie Menschen ohne Job als "Hilfsbedürftige" darstellt, statt die Absurdität des Vollbeschäftigungs-Dogmas zu hinterfragen.
Ebene 2: Die KI-Realität, die wir ignorieren
Während wir uns über 50-jährige Arbeitslose sorgen, entwickeln sich KI-Agenten, die in 5-10 Jahren ganze Branchen obsolet machen werden. Nicht nur Fabrikarbeit – auch Bürojobs, kreative Tätigkeiten, sogar medizinische Diagnosen.
Die kommende Arbeitsplatz-Apokalypse
Die Zahlen sind eindeutig: KI-Systeme werden nicht nur einzelne Jobs ersetzen, sondern ganze Kategorien menschlicher Arbeit überflüssig machen. Was wir heute als "strukturelle Arbeitslosigkeit" von 50-Jährigen erleben, ist nur der Vorgeschmack auf eine Zukunft, in der Millionen von Menschen – unabhängig vom Alter – keinen traditionellen Arbeitsplatz mehr finden werden.
Die Diskussion um "Zu alt zum Arbeiten, zu jung für die Pension" ist wie das Arrangieren der Liegestühle auf der Titanic. Das eigentliche Problem ist nicht, dass manche Menschen keinen Job finden – das Problem ist, dass wir so tun, als gäbe es für alle genug Jobs, obwohl wir genau wissen, dass das nicht stimmt.
BGE als einzige realistische Lösung
Hier wird die Leerstelle im Momentum-Artikel besonders deutlich: Das bedingungslose Grundeinkommen wird mit keinem Wort erwähnt. Dabei ist es die naheliegendste – und vielleicht einzige – Antwort auf die kommende Automatisierungswelle und das Pensionsdilemma.
Ein BGE würde nicht nur Kinderarmut, Altersarmut und Erwerbsarmut bekämpfen, sondern auch "Freiheit bei der Lebensgestaltung" ermöglichen, "so können Menschen ihren Interessen und Begabungen nachgehen und sich somit bestmöglich in die Gesellschaft einbringen".
Die Finanzierung? Während Kritiker immer die Kosten eines BGE anführen, verschweigen sie die enormen Einsparungen durch Bürokratieabbau und die neuen Einnahmequellen, die eine digitalisierte Wirtschaft ermöglicht. Eine Automatisierungssteuer auf KI-Systeme und Roboter könnten die BGE-Kosten decken – und würden genau dort ansetzen, wo die Gewinne der digitalisierten Wirtschaft entstehen. Aber auch eine radikale Änderung des Steuersystems hin zu einer Geldtransaktionssteuer (GTS) würde das BGE und viele andere Zukunftsprobleme lösen können.
Ein BGE würde die gesamte Debatte reframen: Von "Wie finden alle einen Job?" zu "Wie gestalten wir eine Gesellschaft, in der Menschen auch ohne traditionelle Arbeit ein würdiges Leben führen können?"
Das Pensionsdilemma: Eine mathematische Unmöglichkeit
Besonders zynisch wird der Artikel beim Thema Pensionsalter. Während die Industriellenvereinigung die Anhebung des Pensionsalters auf 70 Jahre fordert und die Regierung Altersteilzeit und Korridorpension beschränken will, steigt die Arbeitslosenquote bei Männern mit 64 Jahren bereits auf jeden Siebten.
Hier offenbart sich die ganze Absurdität des Systems: Menschen sollen länger arbeiten, während sie gleichzeitig früher aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden. Das ist wie das Quadrieren des Kreises – mathematisch unmöglich, politisch aber trotzdem gefordert.
Die vorgeschlagenen Lösungen – Bonus-Malus-Systeme für Unternehmen, Quote für ältere Arbeitnehmer – sind Pflaster auf einer klaffenden Wunde. Sie behandeln die Symptome einer Gesellschaft, die Menschen nach ihrem 50. Lebensjahr systematisch als "zu alt" abstempelt, sie aber gleichzeitig bis 67 oder 70 in Beschäftigung halten will.
Ein BGE würde dieses Dilemma elegant lösen: Menschen könnten selbst entscheiden, wann sie aus dem Arbeitsleben aussteigen, ohne in Armut zu geraten. Der Druck, Menschen künstlich im Arbeitsmarkt zu halten, würde verschwinden. Stattdessen könnten 50-Jährige ihre Erfahrung ehrenamtlich einsetzen, Startups gründen oder sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern – alles gesellschaftlich wertvolle Tätigkeiten, die heute nicht entlohnt werden.
Das systemische Versagen der Debatte
Was wir hier erleben, ist ein fundamentales Versagen unserer politischen und medialen Debatte. Statt über die Grundfragen zu diskutieren – Wie verteilen wir Wohlstand in einer automatisierten Gesellschaft? Wie definieren wir menschliche Würde jenseits der Lohnarbeit? – verheddern wir uns in Detailfragen der Arbeitslosenhilfe.
Die politische Realität in Österreich
Bei der Nationalratswahl 2024 positionierten sich nur zwei Kleinparteien ("Der Wandel" und die KPÖ) positiv zum BGE. Die SPÖ antwortete trotz interner Arbeitsgruppen zum BGE mit "Nein" und hält an der "bedarfsorientierten Mindestsicherung" fest. Die NEOS lehnen sowohl Mindestsicherung als auch BGE ab und fordern stattdessen ein "liberales Bürgergeld".
Die größten deutschen Gewerkschaften IG Metall und ver.di lehnen das BGE ab und bezeichnen es als "Abstellprämie" oder "Stilllegungsprämie" ohne Perspektive in der Erwerbsarbeit.
Die Normalisierung der Krise
Artikel wie der von Momentum normalisieren Massenarbeitslosigkeit als "leider unvermeidlich" und konzentrieren sich auf Schadensbegrenzung. Dabei wäre jetzt der Zeitpunkt, radikale Alternativen zu diskutieren – bevor die KI-Revolution uns alle vor vollendete Tatsachen stellt.
Die unbequeme Wahrheit ist: Wir brauchen eine komplett neue Erzählung über Arbeit, Wert und menschliche Würde. Solange Journalismus aber in den alten Denkmustern verhaftet bleibt – und von Institutionen finanziert wird, die vom Status quo profitieren – wird er Teil des Problems bleiben.
Der Eisberg voraus
Die 50-jährigen Arbeitslosen von heute sind die Vorboten einer viel größeren Krise. In zehn Jahren werden wir auf Artikel wie den von Momentum zurückblicken und uns fragen, wie wir so blind sein konnten. Wie wir ernsthaft glauben konnten, dass sich das Problem mit "besserer Jobberatung" und "Umschulungen" lösen lässt.
Die KI-Revolution ist kein fernes Zukunftsszenario – sie passiert jetzt, in Echtzeit. Und während wir die Liegestühle neu arrangieren, rast die Titanic ungebremst auf den Eisberg zu.
Wie BGE-Befürworter zu Recht fragen: "Was, wenn Automatisierung viele Jobs kostet? Alles, was beschreibbar ist, kann für Roboter programmiert werden, um es schneller, länger, fehlerfrei, ohne Urlaub, Krankheit, Schwangerschaft und Streik, unzählige Male zu tun."
Vielleicht ist es Zeit, dass wir aufhören, die Symptome zu behandeln, und anfangen, über die wirklichen Lösungen zu sprechen. Auch wenn das bedeutet, die Gewerkschaften und ihre medialen Sprachrohre zu verärgern. Denn eines ist sicher: Die nächste Generation wird uns nicht dafür danken, dass wir die bequemen Lügen erzählt haben, statt die unbequemen Wahrheiten.
Michael Kainz ist Herausgeber von The Digioneer und Autor von "The Awakening". Er beschäftigt sich seit Jahren mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der digitalen Transformation.
Zum Weiterlesen
 The DigioneerJamie Walker
The DigioneerJamie Walker
 The DigioneerPhil Roosen
The DigioneerPhil Roosen