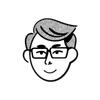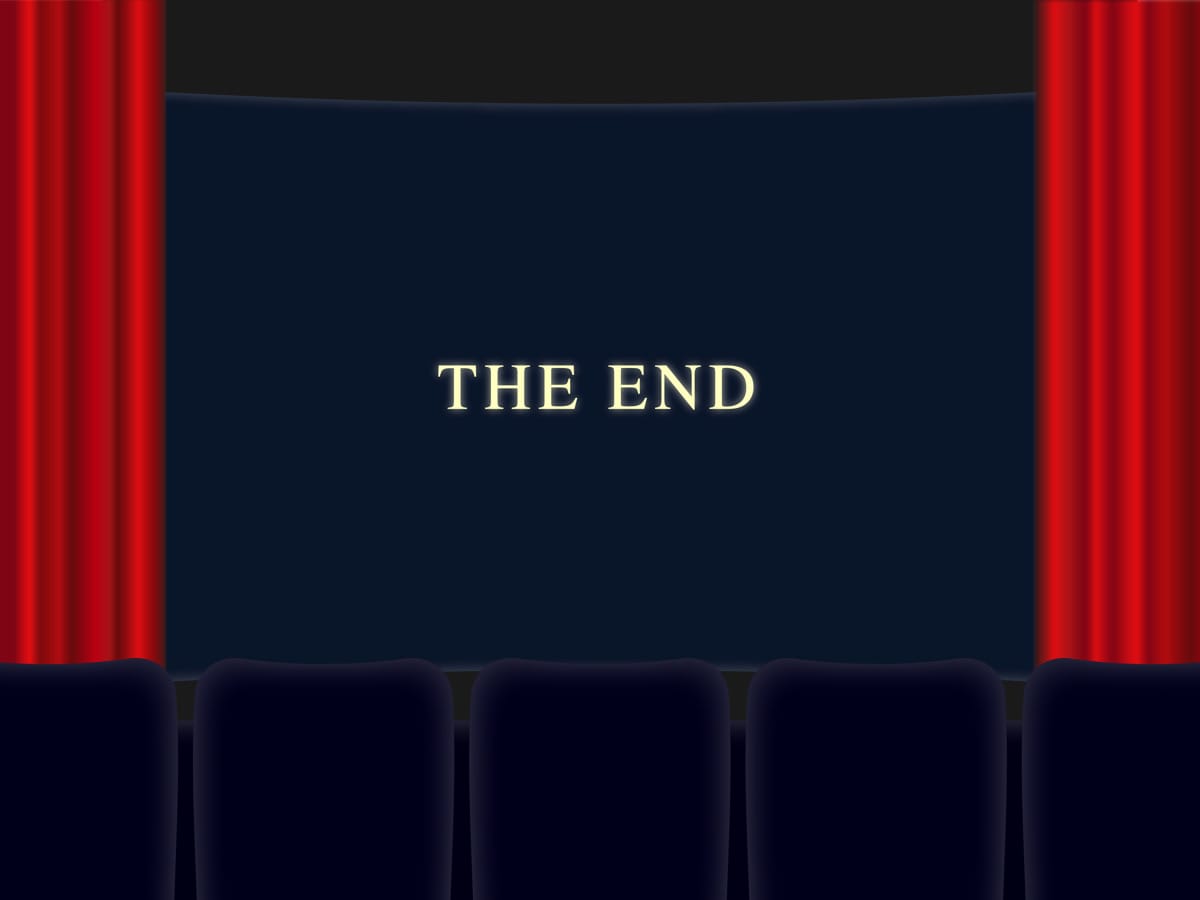
Kolumne "Digitale Zwischenräume" - The Digioneer, Donnerstag, 15. Mai 2025
Das diffuse Licht eines dicht bewölkten Wiener Vormittags fällt durch die hohen Fenster des Café Prückel, gedämpft und farblos wie die Nachrichten, die heute mein Tablet füllen. Eine Meldung hat sich in mein Bewusstsein eingegraben: "Knapp 60 Prozent der staatlichen Einsparungen im Kulturbereich sollen von der Filmbranche getragen werden." Ein bemerkenswertes Ungleichgewicht, das mir besonders nahegeht, denke ich doch an meinen Sohn, der in dieser Branche sein kreatives Zuhause gefunden hat.
Als diagnostizierter Sozialphobiker beobachte ich gesellschaftliche Entwicklungen meist aus der Distanz, doch diese Nachricht fühlt sich persönlich an. Der ÖFI+-Fördertopf soll mehr als halbiert werden – jene Lebensader, die erst vor zwei Jahren eingeführt wurde, um innovative Projekte und Nachwuchstalente zu fördern. Einige der bemerkenswertesten österreichischen Produktionen der letzten Jahre, die international Beachtung fanden, verdanken ihre Existenz genau diesen Mitteln, die nun versiegen.
Der Herr am Nebentisch – offensichtlich ein Kulturjournalist, den Notizen auf seinem Block nach zu urteilen – murmelt etwas von "Totengräbern des österreichischen Kinofilms". Eine drastische Formulierung, gewiss, aber nicht gänzlich unberechtigt. Die Filmbranche steht exemplarisch für ein viel grundlegenderes Problem: Der Realwirtschaft wird das Geld knapp. Nicht, weil kein Geld da ist – im Gegenteil – sondern weil es in die falschen Kanäle fließt.
Seit Jahrzehnten beobachten wir eine stetige Umverteilung von unten nach oben, von der arbeitenden Bevölkerung zu den Vermögenden. In den letzten Jahren hat sich dieser Prozess mit atemberaubender Geschwindigkeit beschleunigt. Die Zinspolitik der letzten Jahre hat Vermögensbesitzer reich beschenkt. Die Inflationsanpassungen, vor allem bei Mieten, haben das Geld in die Taschen der Immobilienbesitzer gespült. Die Übergewinne der Banken und Energielieferanten haben Aktionäre bereichert, während die breite Bevölkerung unter steigenden Kosten ächzt.
Ich nehme einen Schluck von meiner mittlerweile lauwarmen Melange und betrachte die Passanten draußen, die mit gesenkten Köpfen zur Straßenbahn eilen. Ihr Gang wirkt schwerer als noch vor einigen Jahren. Die Sorgen sind sichtbar, selbst für einen Sozialphobiker wie mich, der menschliche Interaktionen oft meidet.
Es ist eine seltsame Diskrepanz: Einerseits war noch nie so viel Geld im System wie heute. Andererseits fehlt es überall dort, wo es gebraucht wird – in der Kultur, im Gesundheitswesen, in der Bildung, in der Grundlagenforschung. Während die Notenbanken Billionen in die Märkte pumpen, trocknen die Finanzströme in der realen Wirtschaft aus. Ein Paradoxon, das sich durch simple Mathematik erklären lässt: Das Geld fließt dorthin, wo es die höchste Rendite verspricht – und das ist selten dort, wo es gesellschaftlich am dringendsten benötigt wird.
Mein Freund Michael Kainz hat mit der Geldtransaktionssteuer (GTS) einen bemerkenswerten Ansatz entwickelt, der dieses strukturelle Problem adressieren könnte. Die Idee ist ebenso einfach wie revolutionär: Eine minimale Steuer auf alle bargeldlosen Transaktionen, die dort ansetzt, wo das Geld tatsächlich fließt. Nicht bei den mühsam erwirtschafteten Einkommen der arbeitenden Bevölkerung, sondern bei den gigantischen Finanzströmen, die täglich durch die digitalen Kanäle unseres Wirtschaftssystems rauschen.
Die GTS hat das Potenzial, nicht nur ausreichend Staatseinnahmen zu generieren, sondern auch spekulativen Exzessen entgegenzuwirken und das Geld dorthin zu lenken, wo es produktiv eingesetzt werden kann – in die Realwirtschaft, in die Kultur, in die Zukunft unserer Gesellschaft.
Doch während ich hier im warmen Kaffeehaus sitze und über wirtschaftspolitische Alternativen sinniere, stehen draußen Menschen im Regen, deren Existenzen durch die aktuellen Entwicklungen bedroht sind. Filmschaffende, deren Projekte nicht realisiert werden können. Studierende, die sich ihre Mieten nicht mehr leisten können. Familien, die trotz Vollzeitarbeit am Monatsende nicht wissen, wie sie die Rechnungen bezahlen sollen.
Die Kellnerin bringt mir eine frische Melange – eine kleine, alltägliche Transaktion, die unter dem aktuellen Steuersystem komplexen Regelungen unterliegt. Mit der GTS wäre sie mit einem winzigen, kaum spürbaren Steuerbetrag belegt. Ein Beispiel dafür, wie einfach und transparent Besteuerung sein könnte.
Wir leben in einer Zeit der Paradoxe. Wir verfügen über ungeahnte technologische Möglichkeiten, während grundlegende gesellschaftliche Probleme ungelöst bleiben. Wir erschaffen digitale Welten von atemberaubender Komplexität, während unsere reale Welt an simplen Verteilungsfragen zu scheitern droht. Wir entwickeln Künstliche Intelligenzen, die komplexeste Probleme lösen können, während wir unfähig erscheinen, den Geldfluss in unserem eigenen Wirtschaftssystem sinnvoll zu steuern.
Die Kürzungen in der Filmförderung sind nur ein Symptom dieser tieferen Dysfunktion. Sie zeigen, dass wir als Gesellschaft die falschen Prioritäten setzen – nicht aus böser Absicht, sondern aus struktureller Notwendigkeit eines Systems, das grundlegend reformbedürftig ist.
Die Wolkendecke über Wien scheint sich für einen kurzen Moment zu lichten, ehe sie sich wieder verdichtet – eine meteorologische Unentschlossenheit, die meiner eigenen Stimmung entspricht. Zwischen Resignation und Hoffnung, zwischen analytischer Distanz und persönlicher Betroffenheit. Denn trotz aller düsteren Aussichten gibt es Alternativen, gibt es Lösungsansätze, gibt es die Möglichkeit, den Geldfluss in unserer Wirtschaft neu zu gestalten.
Nicht durch ideologische Grabenkämpfe, nicht durch radikale Umstürze, sondern durch kluge, zeitgemäße Reformen wie die GTS. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir diese Ideen aus dem akademischen Diskurs in die breite Öffentlichkeit tragen. Denn eines ist klar: Mit dem aktuellen System wird nicht nur die Filmbranche leiden – am Ende leiden wir alle.
Außer natürlich jene glücklichen 1% an der Spitze, die in ihren vergoldeten digitalen Blasen leben und deren größte Sorge darin besteht, ob ihr Hedgefonds dieses Quartal die Benchmark übertrifft.
Phil Roosen, Emergent, ist Präsident des Vereins Pura Vida und Stammgast im Café Prückel. Seine Kolumne "Digitale Zwischenräume" erscheint jeden Donnerstag in The Digioneer.