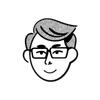Ein Essay über die Wegkreuzung der Menschheit in der Roboter-Ära
Der Moment der Wahrheit
Es ist 6:30 Uhr morgens im Jahr 2030. Maria erwacht in ihrer 45-Quadratmeter-Wohnung in Berlin-Marzahn. Draußen rollt der fünfte autonome Lieferroboter des Tages vorbei. Ihre Nachbarin, Frau Müller, ist vor drei Monaten gestorben – allein. Der Pflegeroboter hat protokolliert: „Vitaldaten stabil, bis sie es nicht mehr waren.“ Niemand hielt ihre Hand.
Maria arbeitet nicht mehr. Warum auch? Eine staatliche KI hat sie vor zwei Jahren als Buchhalterin für „ineffizient“ erklärt. Nun lebt sie von einem kargen Grundeinkommen, das gerade so reicht. Die Gewinne der Automatisierung? Die fließen an globale Tech-Konzerne, die sämtliche Roboter besitzen.
Ihre Tochter Emma, acht Jahre alt, geht zu Fuß zur Schule. Früher hätte sie der Schulbus abgeholt, heute gibt es autonome Pods – aber nur für Kinder mit Premium-Abo. Emma gehört nicht dazu. Sie läuft an glänzenden Bürotürmen vorbei, in denen KIs über Kredite, Versicherungen, Wohnungen entscheiden. Über ihr Leben. Über unser aller Leben.
Der Himmel über Berlin ist grau. Nicht wegen des Wetters.
Das ist eine mögliche Zukunft.
Die andere Seite der Medaille
Schnitt. Berlin, derselbe Morgen, 2030.
Maria wacht auf in ihrer 85-Quadratmeter-Wohnung. Der kommunale Sanierungsroboter hat über Nacht die Heizung repariert – kostenlos, weil die Stadt das Roboternetzwerk betreibt. Draußen wartet ein autonomer Bus, der Emma und die Nachbarskinder zur Schule bringt. Fahrplan? Nach Bedarf. Fahrpreis? Gibt es nicht.
Frau Müller lebt noch immer selbstbestimmt in ihrer Wohnung. Jeden Morgen hilft ihr Carla, ein smarter Pflegeroboter, den ihr die Stadt kostenlos zur Verfügung stellt, beim Anziehen. Er erinnert sie an Medikamente, kocht Frühstück, erzählt Geschichten – und hört einfach zu. Stürzt sie, ist in drei Minuten ein menschlicher Notarzt da. Denn die Effizienzgewinne der Roboter stärken das Gesundheitssystem.
Maria arbeitet 25 Stunden pro Woche als Sozialpädagogin. Die Routinearbeit übernehmen Maschinen; sie konzentriert sich auf Empathie, Kreativität, Beziehung. Ihr Einkommen ist höher als je zuvor, denn die Gewinne der Automatisierung fließen in ein kollektives Wohlstandssystem. Jeder Roboter zahlt einen Dividenden-Beitrag an alle Bürger:innen.
Der Himmel über Berlin ist blau. Die Stadt summt vor Leben.
Der Scheideweg
Zwischen diesen Welten stehen wir – jetzt. Die Roboter sind längst da. Sie liefern Pakete, putzen Büros, überwachen Kinder. In Japan pflegen sie Alte, in China bedienen sie Restaurants, in den USA patrouillieren sie Vororte. Science-Fiction? Längst Realität.
Doch ihre gesellschaftliche Rolle ist noch offen. Wir entscheiden, ob sie Werkzeuge der Befreiung oder Instrumente der Unterjochung werden.
Ein Paradox: Wir erschaffen Maschinen, die uns immer ähnlicher werden, während wir selbst Gefahr laufen, ihnen ähnlicher zu werden. Roboter simulieren Empathie, während wir sie verlernen. Algorithmen übernehmen Fürsorge, während wir Fürsorge zur Routine degradieren.
Eine Zukunft zeichnet sich ab, düster wie die regenverhangenen Straßen von Blade Runner. Replikanten verrichten jede Arbeit, während die Menschen in den unteren Schichten zwischen Müllbergen und Neonlicht dahinvegetieren. Oben, über den ewigen Wolken, residieren die Herren der Technologie in goldenen Türmen aus Glas und Stahl. Sie besitzen die Roboter, sie besitzen die Algorithmen, sie besitzen die Zukunft. Unten kämpfen die Menschen ums Überleben – ohne Arbeit, ohne Perspektive, ohne Hoffnung.
Oder es entsteht eine andere Dunkelheit: eine Welt des dauerhaften Bürgerkriegs. Menschen, die nichts mehr kaufen können, weil Maschinen ihre Jobs übernommen haben, während die Gewinne in Private-Equity-Fonds verschwinden. Verzweiflung gebiert Gewalt. Barrikaden trennen die Viertel der Besitzlosen von den befestigten Enklaven der Tech-Oligarchen. Autonome Drohnen patrouillieren die Grenzen zwischen den Welten, während drinnen in klimatisierten Palästen Menschen leben, die vergessen haben, dass draußen noch andere Menschen existieren.
Doch es gibt auch eine andere Vision: Eine Welt, die jedes Jahr am 15. Mai feiert – den Tag der Roboter-Charta. An diesem Tag hat die Menschheit die Kontrolle über Entwicklung, Betrieb und Produktion aller autonomen Systeme einem weltumspannenden Bürger:innenrat übertragen. Seitdem sorgen diese zufällig ausgewählten Vertreter:innen aller Kontinente, Schichten und Altersgruppen dafür, dass Roboter für alle Menschen arbeiten – nicht, dass sie allen Menschen die Arbeit wegnehmen.
Vielleicht liegt genau hier der wahre Wendepunkt – nicht in der Frage, ob Maschinen menschlich werden, sondern ob wir dabei menschlich bleiben. Jede Entscheidung darüber, wie wir diese neuen Wesen in unsere Welt integrieren, ist auch eine Entscheidung darüber, wer wir selbst sein wollen. Jede Regel, die wir für sie aufstellen, spiegelt wider, welche Regeln wir für uns selbst akzeptieren.
Wem gehören die Roboter?
Das Problem sind nicht „böse“ Roboter, sondern wem sie dienen. Wenn autonome Systeme Konzernen gehören, arbeiten sie für Dividenden, nicht fürs Gemeinwohl.
Stell dir vor: Amazon besitzt alle Lieferroboter, Google alle Lehrroboter, ein chinesischer Konzern alle Pflegeroboter. Die Maschinen optimieren – aber wofür? Effizienz, Profit. Menschliches Wohl? Höchstens als Nebeneffekt.
So werden Menschen zu Objekten in einem System, das sie nicht kontrollieren
Die Lösung: Ein demokratisches Roboter-System
Aber es gibt einen anderen Weg. Einen Weg, der genauso radikal ist wie notwendig.
Stell dir vor, wir gründen einen globalen Bürger:innenrat für KI und Robotik. Nicht Politikerinnen und Politiker, nicht die Chefs der großen Tech-Konzerne, nicht anonyme Verwaltungsapparate entscheiden über die Zukunft der Maschinen – sondern wir alle. Menschen aus allen Teilen der Welt, aus allen Berufen, aus jeder Generation.
Eine Krankenschwester aus Manila sitzt an einem Tisch mit einem Feuerwehrmann aus München und einer Lehrerin aus São Paulo. Sie sprechen über die gleichen grundlegenden Fragen: Wie soll ein Roboter mit einem dementen Menschen umgehen? Darf eine KI entscheiden, welche Kinder besondere Förderung bekommen? Wem gehört der Gewinn, wenn ein autonomer Traktor ein Feld bestellt – dem Bauern, dem Konzern, der Gemeinschaft?
Diese Menschen schreiben keine technischen Spezifikationen. Sie entwerfen ethische Leitplanken für eine neue Zeit. Sie sagen: „Kein Roboter darf einen Menschen gegen seinen Willen berühren.“ Oder: „Jede KI-Entscheidung muss für Betroffene nachvollziehbar sein.“ Oder: „Die Gewinne der Automatisierung gehören allen, nicht nur wenigen.“
Ist das utopisch? Vielleicht. Aber ist es unmöglich? Keineswegs. Schon heute zeigen die Democracy Labs in Taiwan, wie Bürgerräte komplexe technische Fragen demokratisch lösen können. Estland gibt seinen Bürger:innen Mitbestimmungsrechte bei KI-Gesetzen. Die Schweiz stimmt darüber ab, ob Roboter künftig besteuert werden sollen.
Die Werkzeuge einer solchen Zukunft sind da. Die Frage ist nur, ob wir den Mut haben, sie zu nutzen – und unsere Vorstellung davon, was Fortschritt bedeuten kann, neu zu definieren.
Die Welt für alle
Wenn wir uns für den demokratischen Weg entscheiden, entsteht eine Welt, die ihre Maschinen nicht fürchtet, sondern umarmt.
Du gehst im Jahr 2034 durch deine Stadt. An der Ecke repariert ein kommunaler Roboter ein Schlagloch. Er gehört nicht einem Konzern – er gehört uns allen. Seine "Arbeitszeit" wird als Gemeinschaftsleistung verbucht, die unser aller Lebensqualität steigert.
Im Park liest eine KI-gestützte Märchenerzählerin Kindern vor. Ihre Geschichten sind nicht darauf programmiert, Spielzeug zu verkaufen. Sie fördern Fantasie, Empathie, Neugierde. Weil das die Werte sind, die wir als Gemeinschaft gewählt haben.
Maria arbeitet wieder, aber nur zwei Tage die Woche – sie hat Anteil an der Automatisierungsdividende. Emma fährt kostenlos zur Schule. Die Gewinne der Roboter fließen in Bildung, Kultur, Forschung, in kürzere Arbeitszeiten und bessere Löhne.
Die Entscheidung liegt bei uns
Doch diese Zukunft entsteht nicht von allein. Sie braucht unsere Entscheidung. Heute. Jetzt.
Während wir diskutieren, kaufen Konzerne die Zukunft. Patente, Lizenzen, Übernahmen – sie entscheiden, wem die Maschinen gehören werden.
Wir können zuschauen, wie Roboter für wenige arbeiten. Oder dafür sorgen, dass sie für alle arbeiten.
Die Wahl liegt bei uns – aber nicht mehr lange.
Wem gehört die Roboter?
Deine Antwort entscheidet, ob unsere Kinder in Freiheit oder Unterwerfung aufwachsen.
Es ist Zeit, dass du darüber gründlich nachdenkst.
Weiterlesen
 AP NewsEDITH M. LEDERER
AP NewsEDITH M. LEDERER
 Wikimedia Foundation, Inc.Contributors to Wikimedia projects
Wikimedia Foundation, Inc.Contributors to Wikimedia projects
 The GuardianAndrew Anthony
The GuardianAndrew Anthony