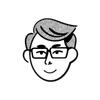Kolumne "Digitale Zwischenräume" - The Digioneer, Donnerstag, 30. Oktober 2025
Die Oktobersonne Sardiniens zeichnet glitzernde Muster auf das türkisfarbene Wasser. Neben mir liegt der Ausdruck der Begründung der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften für die diesjährigen Wirtschaftsnobelpreisträger. Meine Frau ist zum Schwimmen gegangen, unser Wohnmobil steht keine hundert Meter entfernt auf einem fast menschenleeren Campingplatz. Die Herbstferien – jene kostbare Zeit, in der Europa den Massentourismus hinter sich lässt und die wahre Schönheit der Mittelmeerküste wieder sichtbar wird.
Als Präsident von Pura Vida kenne ich den Wert dieser mobilen Freiheit. Als Kolumnist für The Digioneer das Privileg, selbst am Strand über Wirtschaftstheorie nachdenken zu dürfen. Und als diagnostizierter Sozialphobiker die Erleichterung, dass die Herbstferien bedeuten: weniger Menschen, mehr Raum zum Denken.
Joel Mokyr, Philippe Aghion und Peter Howitt – drei Namen, die den meisten so wenig sagen wie die chemische Formel für Sonnencreme. Und doch haben diese Ökonomen etwas Bemerkenswertes geschafft: Sie haben erklärt, warum unsere Welt seit etwa 250 Jahren nicht mehr stagniert, sondern wächst. Warum wir heute nicht mehr leben wie unsere Urgroßeltern, sondern in einer Welt permanenter Veränderung. Und – was mich am meisten fasziniert – sie haben gezeigt, dass dieser Fortschritt alles andere als selbstverständlich ist.
Das Warum hinter dem Was
Mokyr, der niederländische Wirtschaftshistoriker an der Northwestern University, hat die Voraussetzungen für technologischen Fortschritt erforscht. Seine zentrale Erkenntnis klingt fast banal: Für echten, nachhaltigen Fortschritt reicht es nicht zu wissen, dass etwas funktioniert. Wir müssen auch verstehen, warum es funktioniert.
Ein sardischer Fischer warf gerade sein Netz aus – eine Technik, die sich über Jahrtausende kaum verändert hat. Er weiß, dass Fische zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten sind. Aber ob er versteht, warum – die ozeanografischen Strömungen, die Temperaturzonen, die biologischen Zyklen – ist eine andere Frage. Solange das Wissen nur praktisch-empirisch bleibt, bleibt auch die Innovation begrenzt.
Die industrielle Revolution, so Mokyr, begann erst, als wissenschaftliches Verständnis und praktische Anwendung verschmolzen. Als Ingenieure nicht nur probierten, sondern verstanden. Als Gesellschaften nicht nur Neues tolerierten, sondern systematisch förderten.
Ich denke an Michael Kainz, unseren Herausgeber bei The Digioneer, und sein Konzept der Geldtransaktionssteuer. Jahrelang haben Ökonomen gewusst, dass unser Steuersystem Ineffizienzen und Ungerechtigkeiten produziert. Aber erst wenn wir verstehen, warum – die systemischen Mechanismen der Steuervermeidung, die mathematischen Zusammenhänge zwischen Steuerbasis und Verteilungswirkung, die kybernetischen Feedbackschleifen zwischen Regulierung und Innovation – können wir echte Alternativen entwickeln.
Das ist genau Mokyrs Punkt: Innovation braucht tiefes Verständnis, nicht nur oberflächliches Wissen.
Die notwendige Zerstörung
Aghion und Howitt haben 1992 etwas formalisiert, was Joseph Schumpeter bereits intuitiv erfasst hatte: die "schöpferische Zerstörung". Ihre mathematischen Modelle zeigen, dass nachhaltiges Wachstum nur durch einen permanenten Prozess der Erneuerung möglich ist. Neue Produkte, neue Methoden, neue Strukturen verdrängen die alten. Das ist nicht nur ein Nebeneffekt von Fortschritt – es ist der Fortschritt.
Eine Möwe kreist über dem Wasser, stößt herab, verfehlt ihre Beute. Sie kreist erneut, passt ihre Technik an, stößt wieder zu. Evolution in Echtzeit – schöpferische Zerstörung im Tierreich. Das Alte (die erste Methode) wird verworfen, das Neue (die angepasste Technik) übernimmt.
In der Wirtschaft ist dieser Prozess schmerzhafter. Unternehmen verschwinden, Geschäftsmodelle sterben, Fähigkeiten werden obsolet. Die Schreibmaschine wurde vom Computer verdrängt, der Computer vom Laptop, der Laptop vom Tablet. Jeder Schritt war "kreativ" für die Gewinner und "destruktiv" für die Verlierer.
Aghion warnte in seiner Nobelpreis-Rede eindringlich vor der gegenwärtigen Deglobalisierung und dem neuen Protektionismus. Zollbarrieren und wirtschaftliche Abschottung bremsen nicht nur den Handel – sie bremsen die schöpferische Zerstörung selbst. Wenn etablierte, ineffiziente Strukturen vor Wettbewerb geschützt werden, stagniert die Innovation.
Hier zeigt sich die Relevanz für neue Steuermodelle wie die GTS: Auch unser Steuersystem unterliegt diesem Prinzip. Ein System, das vor 100 Jahren entwickelt wurde – als Kapital noch physisch war, Transaktionen langsam, Grenzen bedeutsam – kann in einer digitalen, globalisierten Welt nicht mehr optimal funktionieren. Die "schöpferische Zerstörung" müsste auch hier wirken.
Aber – und das ist die bittere Ironie – ausgerechnet bei staatlichen Institutionen fehlt oft der Innovationsdruck. Es gibt keinen "Steuermarkt", auf dem ineffiziente Systeme von effizienteren verdrängt werden. Staaten sind Monopolisten in Sachen Steuern. Deshalb ist die politische Debatte so entscheidend: Sie muss den Wettbewerbsdruck ersetzen, der in privaten Märkten automatisch existiert.
Die europäische Innovationslücke
Aghion hat ein spezielles Problem Europas identifiziert: Wir forschen brillant, aber wir überführen Forschung nicht in Innovation. Europa produziert Nobelpreisträger und Patente – aber die großen, weltverändernden Unternehmen entstehen anderswo.
Meine Frau kommt zurück vom Schwimmen, setzt sich neben mich, greift nach ihrem Smartphone. "Schau mal, was ich im Wasser fotografiert habe" – ein kalifornisches Gerät mit koreanischem Display und chinesischer Fertigung. Europäische Technologie steckt darin, aber unsichtbar, im Hintergrund, in Patenten und Zulieferkomponenten.
Das Steuersystem ist ein perfektes Beispiel für dieses europäische Dilemma. Wir haben exzellente Wirtschaftswissenschaftler, die die Ineffizienzen unserer Steuersysteme analysieren. Wir haben präzise Modelle, die zeigen, wie alternative Systeme funktionieren könnten. Aber die Umsetzung? Fehlanzeige.
Die GTS ist keine neue Idee. Varianten wurden diskutiert, modelliert, in akademischen Papieren durchgerechnet. Aber der Sprung von der Theorie zur Implementierung – genau hier versagt Europa systematisch. Zu viele Vetopunkte, zu viele etablierte Interessen, zu wenig politischer Mut für "schöpferische Zerstörung" im institutionellen Bereich.
Die Mathematik des Fortschritts
Was mich an der Arbeit von Aghion und Howitt besonders fasziniert: Sie haben komplexe soziale Prozesse in mathematische Modelle übersetzt. Ihre Gleichungen beschreiben, wie Innovationen sich ausbreiten, wie Märkte reagieren, wie Wachstum entsteht. Das ist keine sterile Akademik – es ist das "Warum-Wissen", von dem Mokyr spricht.
Die Sonne steht bereits tiefer, wirft längere Schatten. Ein älteres italienisches Paar baut seinen Liegestuhl auf, genau dort, wo jetzt der Schatten beginnt. Erfahrungswissen – sie wissen, wo in einer Stunde die Sonne stehen wird. Aber verstehen sie die Astronomie dahinter? Vermutlich nicht. Und für ihren Zweck reicht es.
Bei Steuersystemen reicht es nicht. Hier brauchen wir mathematische Modelle, Simulationen, präzise Vorhersagen. Die GTS von Michael Kainz ist deshalb so interessant, weil sie nicht nur eine Idee ist, sondern auf soliden ökonomischen Modellen basiert. Die Simulationen zeigen, wie verschiedene Steuersätze wirken würden, welche Verteilungseffekte entstehen, wie Kapitalströme reagieren.
Das ist genau das, was die Nobelpreisträger fordern: wissenschaftliches Verständnis als Basis für Innovation. Nicht ideologisches Wunschdenken, sondern mathematisch fundierte Analyse.
Die Offenheit der Gesellschaft
Mokyr betonte in seiner Forschung immer wieder: Technologischer Fortschritt braucht offene Gesellschaften. Gesellschaften, die Neues zulassen, die Veränderung nicht blockieren, die bereit sind, Altes loszulassen.
Die Geschichte ist voll von Gesellschaften, die diesen Test nicht bestanden haben. China war technologisch führend – bis konfuzianische Orthodoxie Innovation erstickte. Das Osmanische Reich hatte Druckpressen – verbot sie aber, weil sie die Autorität religiöser Schriftgelehrter bedrohten. Europa selbst durchlebte Jahrhunderte der Stagnation, bis die Aufklärung Denkblockaden aufbrach.
Ein junges Paar baut gerade ein futuristisches Zelt auf – eines dieser aufblasbaren, die in Sekunden stehen. Ihre Großeltern würden staunen. Aber die eigentliche Innovation ist nicht das Zelt – es ist die Bereitschaft, alte Campingformen loszulassen, Neues auszuprobieren.
Bei Steuern ist diese Offenheit besonders schwierig. Das aktuelle System ist komplex, undurchsichtig, voller Ausnahmen und Privilegien. Aber es ist vertraut. Menschen haben ihre Erwartungen, ihre Strategien, ihre eingeübten Verhaltensweisen darauf aufgebaut. Eine fundamentale Steuerreform bedeutet: All das neu lernen.
Die "schöpferische Zerstörung" ist hier besonders schmerzhaft. Steuerberater verlieren ihre Expertise. Softwareunternehmen ihre Produkte. Lobbyisten ihre Hebel. Und Menschen ihre gewohnten Strategien zur Steuervermeidung. Kein Wunder, dass der Widerstand massiv ist.
Die Warnung vor der Stagnation
Das Stockholmer Komitee wählte seine Worte in der Begründung sorgfältig: "Wirtschaftswachstum ist keine Selbstverständlichkeit." Das ist keine abstrakte akademische Feststellung – es ist eine Warnung. Die letzten 250 Jahre waren historisch einzigartig. Davor stagnierten Gesellschaften über Jahrhunderte. Es gibt keine Garantie, dass unser Wachstum weitergehen wird.
Die Sonne berührt nun den Horizont, taucht das Meer in goldenes Licht. Meine Frau packt ihre Sachen zusammen. "Noch zehn Minuten", bitte ich. Sie lächelt verständnisvoll – sie kennt diese Momente, wenn mich ein Gedanke nicht loslässt.
Die Mechanismen der "schöpferischen Zerstörung" aufrechtzuerhalten – das ist die Herausforderung unserer Zeit. Es bedeutet: Ineffiziente Strukturen nicht künstlich am Leben erhalten. Privilegien nicht zementieren. Innovation nicht durch Überregulierung ersticken. Aber auch: Die soziale Sicherheit schaffen, die Menschen brauchen, um Veränderung zu akzeptieren.
Das Steuersystem ist dabei zentral. Es finanziert nicht nur den Staat – es prägt die Anreizstrukturen der gesamten Wirtschaft. Ein Steuersystem, das Innovation bestraft und Spekulation belohnt, hemmt schöpferische Zerstörung. Ein System, das Arbeit höher besteuert als Kapitalerträge, verzerrt die Ressourcenallokation. Ein System voller Schlupflöcher privilegiert jene, die sich teure Beratung leisten können.
Die GTS wäre in diesem Sinne selbst ein Akt "schöpferischer Zerstörung": Sie würde ein überholtes System durch ein zeitgemäßeres ersetzen. Schmerzhaft für etablierte Interessen, aber notwendig für gesellschaftlichen Fortschritt.
Der mobile Blick
Wir packen zusammen, kehren zum Wohnmobil zurück. Die mobile Lebensweise, die unser Verein Pura Vida propagiert, ist selbst ein Beispiel für die Themen der Nobelpreisträger. Sie war nur möglich durch technologische Innovation: Satelliteninternet, effiziente Solarzellen, kompakte Wasseraufbereitung. Und sie erfordert gesellschaftliche Offenheit: Die Akzeptanz alternativer Lebensformen, flexible Regulierung, Infrastruktur, die nicht nur den Sesshaften dient.
Morgen fahren wir weiter, Richtung Norden vielleicht, oder bleiben wir noch? Die Freiheit, es nicht zu wissen. Die Freiheit, zu entscheiden, wenn der Moment da ist. Diese Flexibilität – sie ist sowohl Produkt als auch Metapher für die Prinzipien, die die Nobelpreisträger beschreiben.
Meine abschließende Erkenntnis an diesem sardischen Oktobertag: Die Arbeit von Mokyr, Aghion und Howitt ist keine trockene Akademik. Sie beschreibt die fundamentalen Mechanismen, die unsere Welt formen. Mechanismen, die auch bei der Gestaltung von Steuersystemen gelten: Wir brauchen das "Warum-Wissen" (Mokyr), wir müssen "schöpferische Zerstörung" zulassen (Aghion/Howitt), und wir brauchen gesellschaftliche Offenheit für Veränderung.
Die GTS ist dabei nur ein Beispiel – aber ein besonders prägnantes. Sie zeigt, wie theoretisches Verständnis in praktische Innovation übersetzt werden könnte. Ob sie kommt? Das hängt davon ab, ob wir als Gesellschaft bereit sind, das Spiel der "schöpferischen Zerstörung" mitzuspielen. Ob wir das Alte loslassen können, um das Neue zu ermöglichen.
Die Nobelpreisträger haben uns die Werkzeuge gegeben, diese Fragen zu durchdenken. Jetzt liegt es an uns, sie zu nutzen.
Phil Roosen, Emergent bei The Digioneer, schreibt diese Kolumne vom Campingplatz Cala Gonone, Sardinien, wo die Herbstsonne noch wärmt und die Nobelpreis-Begründung neben dem Liegestuhl liegt. Seine Kolumne "Digitale Zwischenräume" erscheint jeden Donnerstag in The Digioneer.
 The DigioneerPhil Roosen
The DigioneerPhil Roosen
 The DigioneerMichael Kainz
The DigioneerMichael Kainz