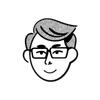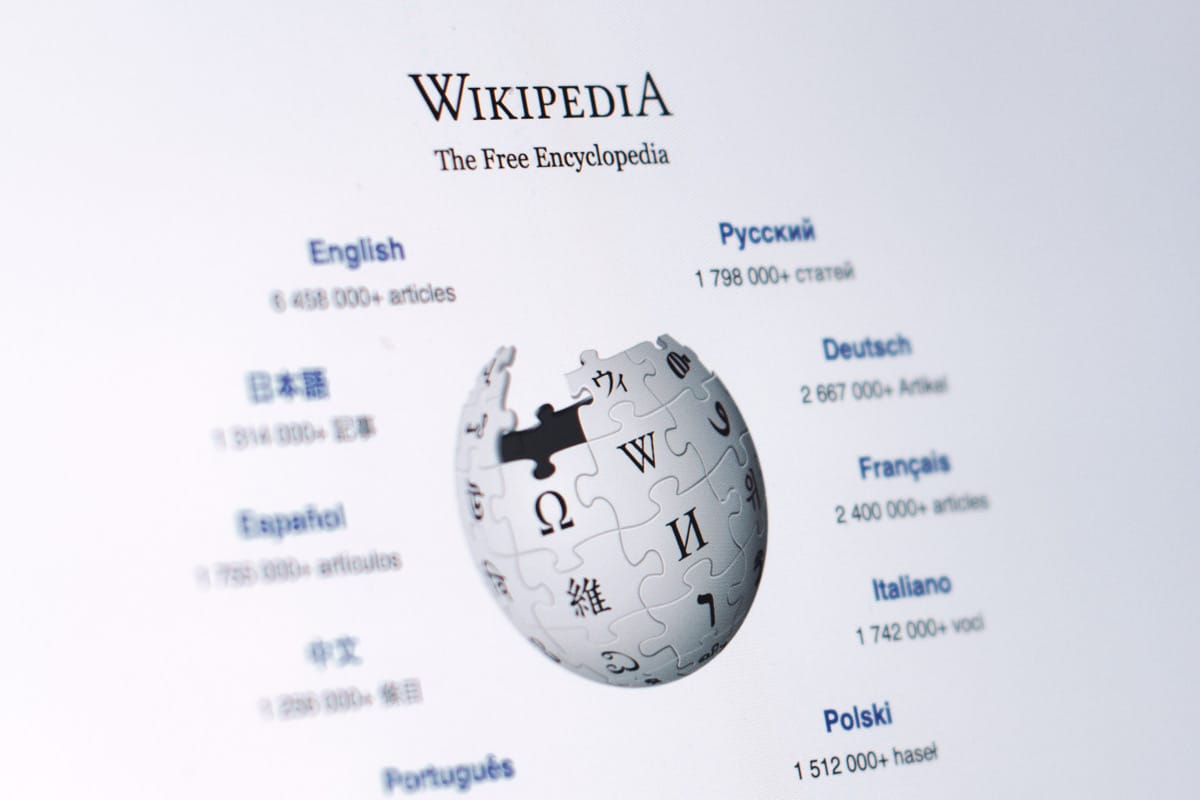
Von Michael Kainz für The Digioneer
Wenn wir heute von digitaler Revolution sprechen, dominieren meist Schlagworte wie Künstliche Intelligenz, Algorithmen oder Big Data die Diskussion. Doch im Schatten dieser technologischen Entwicklungen hat sich ein Projekt etabliert, das unsere Wissensgesellschaft grundlegender verändert hat als viele spektakulärere Innovationen: Die Wikipedia.
Diese digitale Enzyklopädie, geboren aus dem Idealismus einer globalen Gemeinschaft von Freiwilligen, verkörpert einen radikal demokratischen Ansatz zur Wissensverbreitung. Während kommerzielle Plattformen unsere Daten sammeln und monetarisieren, schafft Wikipedia einen Raum, in dem Wissen als gemeinschaftliches Gut verstanden wird – frei zugänglich für alle, unabhängig von wirtschaftlichen Interessen.
Hinter diesem Mammutprojekt stehen Menschen wie Peter Zlabinger, Referent für Kommunikation bei Wikimedia Österreich. In Zeiten, in denen Wissen zunehmend zu einer Handelsware wird, arbeitet er mit einem kleinen Team daran, die Vision des freien Wissens am Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Unsere Wege haben sich nun zum dritten Mal gekreuzt – diesmal zum Thema Wikipedia. Peter und seinen Zwillingsbruder schätze ich besonders für ihre scharfen analytischen Fähigkeiten, ihre gesellschaftliche Haltung und ihre sympathische Art. Im folgenden Interview gibt Peter Einblicke in die Arbeit einer Organisation, die oft im Verborgenen wirkt, aber deren Einfluss auf unsere digitale Wissenskultur kaum zu überschätzen ist.
Interview mit Peter Zlabinger, Referent für Kommunikation bei Wikimedia Österreich
1. Was umfasst deine Rolle bei Wikimedia Österreich und wie schafft ihr es, mit nur 5 Mitarbeitern und einem Budget von etwa 400.000 Euro wirkungsvolle Arbeit zu leisten?
Ich bin Referent für Kommunikation und aktuell umfasst meine Rolle vor allem, mich in die Strukturen von Wikimedia Österreich und der deutschen Wikipedia einzuarbeiten. Danach übernehme ich Teile der Community-Kommunikation nach innen und außen, dazu zählen unser Blog und unsere Social Media-Kanäle, die Kommunikation rund um größere Projekte wie das 25-Jahre-Jubiläum und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich werde auch Teil der Strategieentwicklung sein.
Die Hauptaufgabe der Wikimedia Österreich ist ja die Unterstützung und Förderung der ehrenamtlichen Wikipedianer*innen. Das bedeutet einerseits einen engen Austausch und andererseits, dass wir größere gesellschaftliche Entwicklungen im Auge behalten, die sich auf die Wikipedia auswirken könnten. Dabei hilft, dass mehrere meiner Kolleg*innen selbst seit vielen Jahren Teil der ehrenamtlichen Community sind. Die Wirkkraft entsteht aus meiner Sicht also aus der jahrelangen Arbeit in und mit der Community.
2. Gibt es eine besonders überraschende oder ungewöhnliche Geschichte aus Wikimedia Österreich, die die Öffentlichkeit so noch nicht kennt?
Im Austausch mit meinen Kolleg*innen fiel eine Geschichte schnell und einstimmig: der Donauturm-Streit. Diese Geschichte liegt schon einige Jahre zurück, erregte aber innerhalb der Community großes Aufsehen und schaffte es schlussendlich sogar in österreichische und deutsche Zeitungen. Im Kern stand eine – vermeintlich! – simple Frage: Ist der Donauturm ein Fernsehturm? Man würde meinen, dass sich diese Frage schnell beantworten ließe. Nach einer Diskussion, deren Länge ein Buch füllen könnte und deren Form tiefe Einsicht in den sehr menschlichen Prozess der dialogischen Wahrheitsfindung bot, ging der Streit in die wikipedianische Geschichte ein.
In der Causa Donauturm gerieten architektonische, kulturelle, gesellschaftspolitische, ethische und nationale Differenzen ins Zentrum der Auseinandersetzung, die bei anderen Beiträgen meist nur am Rande mitspielen. Auch die Relevanz Österreichs und österreichischer Thematiken in der deutschen Wikipedia schlugen hier als Themen auf.
Sollte dieses Interview von jemandem gelesen werden, der/die Inspiration für eine wissenschaftliche Arbeit benötigt – der Donauturm-Streit bietet genug Stoff für eine Doktorarbeit. Wie die Debatte zu Ende ging, möchte ich gar nicht spoilern. Einfach den Wikipediabeitrag zum Donauturm lesen!
3. Welche spezifisch österreichischen Themen oder Inhalte fehlen noch in Wikipedia und wie arbeitet ihr daran, diese Lücken zu schließen?
Tatsächlich gibt es eine Portalseite in der deutschen Wikipedia, auf der österreichische fehlende Artikel gesammelt werden – neben der Portalseite für unvollständige und erweiterungsbedürftige Artikel. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie gibt aber zumindest einen ersten Anlaufpunkt, wenn man Lücken schließen möchte. Solche Listen gibt es nicht nur zu Artikeln, sondern auch zu Bildern (Commons) oder Datensätzen (Wikidata).
Von Wikimedia Österreich aus unterstützen wir die Ehrenamtlichen beim Organisieren von z.B. themenbezogenen Events (halbtägig, ganztägig, mehrtägig) oder unterschiedlichen Wettbewerben wie beim nationalen WikiDaheim oder beim internationalen Coordinate Me. Wir folgen dabei auch den Wünschen und dem Feedback der Community.
4. Wie geht ihr mit dem Thema der alternden Wikipedia-Community um? Habt ihr spezielle Ansätze, um jüngere Menschen in Österreich für das Mitwirken zu begeistern?
Das Phänomen der alternden Community ist kein neues, in der Vergangenheit wurde auch schon einiges unternommen, um die Community zu verjüngen und zu diversifizieren, zum Beispiel durch Projekte an Schulen und Universitäten. Die Schwierigkeit liegt vor allem darin, eine anfängliche Begeisterung in langfristige Mitarbeit in der Community umzuwandeln. Dabei stehen wir vor gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen. Sprechen wir beispielsweise Student*innen an, dann liegt in deren Leben noch einiges vor ihnen, durch das Wikipedia-Mitarbeit in der Prioritätensetzung nach hinten rutschen kann – Prüfungsstress, Berufseinstieg und Job, Beziehungen etc. Natürlich ist bei Personen mit stabileren Lebensumständen die Chance höher, dabeizubleiben.
Einer unserer Ansätze in der Zukunft wird darum sein, Menschen über Themen zu erreichen, die für sie persönlich relevant sind. Welche Themen das genau sein werden, ist Teil unserer Strategie, die derzeit noch entwickelt wird. Das kann von Aktivismus- bis zu Lifestylethemen gehen.
5. Was würden viele Menschen über die tägliche Arbeit bei einer Organisation wie Wikimedia Österreich nicht vermuten oder wissen?
Ich kann nicht für andere Menschen und deren Vermutungen sprechen, aber ich kann zumindest sagen, was ich selbst nicht vermutet oder gewusst habe, bevor ich bei Wikimedia Österreich angefangen habe. Mir war das Verhältnis zwischen der Wikipedia als Online-Enzyklopädie und der NGO Wikimedia überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, das wäre ein großes Wikipedia-Ding. Tatsächlich sind die NGO und die Ehrenamtlichen in ihren Tätigkeiten aber streng voneinander getrennt. Das geht sogar so weit, dass uns untersagt ist, während unserer Arbeitszeit in der Wikipedia zu arbeiten. Diese Trennung ist der Idee des Freien Wissens zu verdanken, in der alle Menschen unter denselben Voraussetzungen ihren Beitrag leisten können. Unsere Aufgabe bei Wikimedia ist es, möglichst günstige Voraussetzungen für diese Beiträge zu schaffen, aber nicht mehr.
6. Wie siehst du die Zukunft von Wikimedia in Zeiten zunehmender KI-Nutzung? Bereitet ihr euch konkret auf Herausforderungen vor, die durch KI-Systeme entstehen könnten?
Dass KI unsere ganze Gesellschaft und darum auch Wikipedia und uns bei Wikimedia vor Herausforderungen stellt, ist klar. KIs und Lernassistenten werden ja unter anderem durch Inhalte im Internet trainiert und mit Informationen versorgt. Diese Informationen waren im ersten Schritt immer Informationen, die durch menschliche Forschungsarbeit und Interaktion mit der realen Welt erarbeitet und ins Netz und damit in die Wikipedia getragen wurden. Je selbstverständlicher KIs genutzt werden, desto schneller sinkt in unserer Befürchtung das Verständnis der Bevölkerung, woher diese Informationen ursprünglich kommen – und dadurch auch der Anteil der Personen, der sich aktiv in diese Prozesse einbringt.
Wir bemerken den Einfluss von KIs auch jetzt schon, spätestens seit dem Eintritt von Large Language Models in den gesellschaftlichen Mainstream musste die Wiki-Community aktiv damit umgehen lernen. Die Community sieht KIs als zweischneidiges Schwert, einerseits können Abläufe mit KI-Unterstützung maßgeblich erleichtert und beschleunigt oder überhaupt erst möglich gemacht, andererseits kann mit KI auch allerlei Schindluder getrieben werden. Wenn etwa neue Beiträge vollständig von einer KI erstellt und mit nicht-existierenden Quellen versehen werden. Von Wikimedia-Seite versuchen wir, dieser Ambivalenz Sorge zu tragen, der Umgang mit KIs wird auch Teil unseres Strategieprozesses sein.
7. Was war bisher das erfolgreichste Projekt von Wikimedia Österreich, auf das ihr besonders stolz seid?
Das Projekt der österreichischen Denkmallisten, das die Grundlage für unsere Beteiligung am internationalen Fotowettbewerb Wiki Loves Monuments bildet. Kurz erklärt: In dem Projekt werden in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt Denkmäler enzyklopädisch dokumentiert und für die Ewigkeit bildlich festgehalten.
Das Projekt und die Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt waren einer der Hauptgründe dafür, dass wir als Verein uns so entwickeln und professionalisieren konnten, wie wir es getan haben, also mit einem Büro und Angestellten.
Erfolgreich war das Projekt außerdem, weil durch die Denkmallisten über die letzten Jahre über 95%(!) der österreichischen Denkmäler von ehrenamtlichen Wikipedianer*innen fotografisch dokumentiert werden konnten. Erfolgreich ist es immer noch, weil es nach wie vor läuft und mittlerweile andere Projekte daraus hervorgegangen sind. Dazu zählt zum Beispiel WikiDaheim, ein rein österreichisches Fotowettbewerbsprojekt, bei dem neben Denkmälern auch Bilder aus anderen Kategorien wie Kellergassen und Friedhöfen prämiert werden. Seit ein paar Jahren gibt es auch einen Spezialpreis der UNESCO für immaterielle Kulturgüter, dazu zählen unter anderem Handwerkstraditionen oder Bräuche, die teilweise sehr lokal sind oder sogar nur noch von einer einzelnen Familie am Leben erhalten werden. Eine besondere Verantwortung, der wir unsere Aufmerksamkeit schenken wollen. Die besten Bilder von Denkmälern bei WikiDaheim nehmen dann auch direkt beim internationalen Fotowettbewerb Wiki Loves Monument teil. So schlagen wir die enzyklopädische Brücke zwischen dem kleinen Österreich und der großen Welt.
Nachwort
Ich danke Peter Zlabinger herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch, das einen seltenen Blick hinter die Kulissen der größten Wissensplattform unserer Zeit ermöglicht. Die Arbeit von Wikimedia Österreich zeigt exemplarisch, wie zivilgesellschaftliches Engagement und digitale Innovation zusammenwirken können, um ein Projekt zu tragen, das weit mehr ist als eine bloße Informationsquelle.
In einer Zeit, in der Technologiekonzerne um die Vorherrschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz kämpfen, erinnert uns Wikipedia daran, dass die demokratische Teilhabe an Wissen keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein erkämpftes Gut, das kontinuierlich gepflegt werden muss.
Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit Peter und bin gespannt, wie sich das Projekt Wikipedia in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird – besonders angesichts der Herausforderungen durch KI und der Notwendigkeit, neue, jüngere Mitstreiter zu gewinnen.
Michael Kainz ist Herausgeber von The Digioneer mit Schwerpunkt auf Community-gestützte Technologieprojekte und digitale Partizipation.