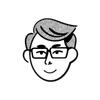Wie ein Verein die Machtbalance zwischen Mietern und Vermietern revolutionieren will
Stell dir ein Wohnhaus vor, in dem du nicht nur wohnst, sondern tatsächlich mitentscheidest. Ein Haus, in dem die Nebenkosten vollständig transparent sind, der Gewinn des Eigentümers gedeckelt ist und du bei allen wichtigen Entscheidungen eine Stimme hast. Utopie? Nicht, wenn es nach dem sich in Gründung befindenden Verein "Faires Wohnen" geht.
Die Wohnrevolution beginnt im Vertrag
Während die Diskussion um bezahlbaren Wohnraum oft bei Mietpreisbremsen und Bauprogrammen steckenbleibt, setzt "Faires Wohnen – Verein für mehr Freude am Mieten" an einem viel fundamentaleren Punkt an: der Machtverteilung zwischen denen, die Wohnraum besitzen, und jenen, die ihn bewohnen.
"Das aktuelle System behandelt Mieter wie Bittsteller, nicht wie gleichberechtigte Partner in einer Wohngemeinschaft", erklärt die Initiatorin des in Gründung befindlichen Vereins. "Hausverwaltungen arbeiten für Eigentümer, während diejenigen, die tatsächlich in den Wohnungen leben, kaum Mitspracherecht haben. Das wollen wir ändern."
Die Idee ist bestechend einfach: Hausbesitzer – egal ob private Investoren, Genossenschaften oder öffentliche Träger – verpflichten sich freiwillig zu einem "Fairwohnen-Kodex" mit drei zentralen Säulen:
- Absolute Transparenz: Sämtliche Kosten, Rücklagen und Investitionspläne werden offengelegt.
- Gewinnbegrenzung: Der Profit wird auf einen fairen Satz begrenzt.
- Demokratische Entscheidungsfindung: Bei Fragen rund ums Haus haben alle Bewohner ein Stimmrecht.
Demokratie im Treppenhaus
Besonders revolutionär ist das geplante Entscheidungsmodell: Bei alltäglichen Fragen soll eine einfache Mehrheit der Mieter reichen. Bei größeren Investitionen oder strukturellen Änderungen wäre eine qualifizierte Mehrheit nötig. Und wenn keine Einigung erzielt werden kann? Dann würde eine unabhängige Stelle – ähnlich der Mieterschutzvereinigung – als Mediator eingeschaltet.
"Nur wenn auch dieser Schritt zu keiner Lösung führt, hätte der Eigentümer das letzte Wort", erläutert die Initiatorin. "Aber selbst dann müsste er seine Entscheidung transparent begründen. Das würde die Dynamik grundlegend verändern."
In einer Zeit, in der Algorithmen unsere Heizung steuern und Smart Home-Systeme unsere Wohngewohnheiten analysieren, geht es um mehr als nur Mitbestimmung: Es geht um digitale Demokratie im unmittelbarsten Lebensraum.
Der digitale Hebel: Transparenz durch Technologie
Die technische Umsetzung soll über eine speziell entwickelte Plattform erfolgen, die alle Finanzdaten, Abstimmungen und Kommunikation zwischen Mietern und Eigentümern bündeln würde. "Mit der passenden digitalen Infrastruktur wird Transparenz zum Kinderspiel", betont der Tech-Berater, der die Initiative unterstützt. "Was früher ein bürokratischer Albtraum gewesen wäre, kann heute durch wenige Klicks erreicht werden."
Diese Digitalstrategie folgt einem internationalen Trend. Im Rahmen der "Affordable Housing Initiative" der EU werden bereits ähnliche digitale Plattformen erprobt, um Transparenz und Mitbestimmung in Wohnprojekten zu fördern. "Was unseren Ansatz besonders macht, ist die konsequente Umsetzung im Alltagsbetrieb normaler Mietwohnungen – nicht nur in speziellen Modellprojekten", erklärt der Tech-Berater.
Die geplante App würde es Mietern nicht nur ermöglichen, bei Entscheidungen abzustimmen, sondern auch Verbrauchsdaten einzusehen, Reparaturen zu melden oder gemeinsame Anschaffungen zu koordinieren. Ein Blockchain-basiertes System soll dabei garantieren, dass alle Abstimmungen manipulationssicher sind.
Von der Idee zur Bewegung
Was als Initiative einer kleinen Gruppe von Wohnrechtsaktivisten begann, hat bereits vor der offiziellen Vereinsgründung Aufmerksamkeit in Fachkreisen erregt. "Wir haben erste Gespräche mit interessierten Hausbesitzern in Wien geführt, und das Feedback ist erstaunlich positiv", berichtet der Tech-Berater.
Die Initiative plant zunächst Pilotprojekte in Wien, bei denen einzelne Hausbesitzer freiwillig Elemente des Konzepts umsetzen. Die Vereinsgründer:innen sind überzeugt: "Sobald die ersten Erfolgsgeschichten sichtbar werden, wird sich das Modell wie ein Lauffeuer verbreiten."
Ein gesellschaftspolitischer Paradigmenwechsel
"Faires Wohnen" versteht sich explizit als gesellschaftspolitische Bewegung. "Es geht nicht nur um bessere Wohnverhältnisse, sondern um einen fundamentalen Wandel im Verständnis dessen, was Eigentum bedeutet", erklärt ein renommierter Soziologe der Uni Wien, der die Initiatoren berät.
Die Gründer argumentieren, dass das Recht auf angemessenes Wohnen ein Grundrecht sei, das nicht dem reinen Profitstreben untergeordnet werden dürfe. "Wenn du für Wohnraum Miete zahlst, erwirbst du nicht nur ein temporäres Nutzungsrecht, sondern auch ein Mitspracherecht", so das zentrale Credo.
Die Herausforderungen
Natürlich stößt die Initiative auch auf Skepsis. Traditionelle Immobilienunternehmen warnen vor Überregulierung und sinkenden Investitionen in den Wohnungsbau. "Die Bedenken nehmen wir ernst", betont Berger. "Deshalb setzen wir auf ein freiwilliges System mit Anreizen statt auf Zwang."
Einen ähnlichen Weg beschreitet bereits die "Neue Wohngemeinnützigkeit" (NWG) in Deutschland, die sozial orientierten Wohnungsanbietern steuerliche Vorteile bietet. Auch Initiativen wie "Fair Wohnen" in Regensburg oder die "National Fair Housing Alliance" in den USA zeigen, dass gemeinwohlorientierte Wohnmodelle durchaus wirtschaftlich tragfähig sein können.
Ein wichtiger Anreiz im Konzept: Eigentümer, die sich dem Kodex verpflichten, erhalten ein "Fair Housing"-Zertifikat, das als Wettbewerbsvorteil dienen könnte. In Zeiten, in der ethisches Investment boomt, interessieren sich immer mehr Anleger für Immobilienmodelle, die soziale Verantwortung mit wirtschaftlicher Nachhaltigkeit verbinden.
Die Vision: Wohnraum als Commons
Langfristig schwebt den Initiator:innen eine Verfassungsänderung vor, die das Recht auf Mitbestimmung im Wohnbereich verankert. "Wohnraum sollte als Commons verstanden werden – als Gemeingut, das zwar in privatem Besitz sein kann, aber immer auch eine gesellschaftliche Komponente hat", erklärt ein Gründungsmitglied des Vereins.
Die Initiative baut dabei auf Erfahrungen internationaler Vorreiter auf. In Deutschland sichert etwa das "Mietshäuser Syndikat" seit den 1990er Jahren Häuser als dauerhaftes Gemeineigentum. In den Niederlanden verwalten Wohnungsgenossenschaften einen Großteil des Mietbestands mit demokratischen Strukturen. Und die UN-Kampagne "The Shift", der sich Städte wie Amsterdam, Barcelona und Berlin angeschlossen haben, definiert Wohnen explizit als Menschenrecht statt als Ware.
"Wir erfinden das Rad nicht neu," gibt das Gründungsmitglied zu, "aber wir kombinieren bewährte Konzepte mit digitalen Möglichkeiten, um sie für die breite Masse zugänglich zu machen. Das ist der innovative Kern unserer Idee."
Bis zur Umsetzung setzt die Initiative auf die Strahlkraft guter Beispiele und plant für den Sommer 2025 die offizielle Vereinsgründung. "Wir sind derzeit in der finalen Vorbereitungsphase und arbeiten an den Statuten und einem detaillierten Konzept", verrät das Gründungsmitglied. "Interessierte können sich bald schon auf unserer provisorischen Website für Updates registrieren."
In einer Zeit, in der die Digitalisierung traditionelle Machtstrukturen aufbricht, könnte das Modell von "Faires Wohnen" beispielhaft dafür stehen, wie die digitale Revolution auch zu mehr Demokratie im Alltag führen kann. Die Frage ist nicht mehr, ob ein solcher Wandel kommt – sondern nur noch, wie schnell wir ihn gemeinsam gestalten.
Was meinst du: Würdest du in einem "Fairwohnen"-Haus leben wollen? Diskutiere mit uns in den Kommentaren!
Dieser Artikel erschien in The Digioneer, April 2025.
Share this article
The link has been copied!