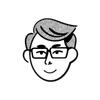Kommentar von Michael Kainz - The Digioneer, 21. März 2025
Heute Morgen lag wieder eine dieser unangenehmen E-Mails in meinem Posteingang: Die Hausverwaltung meines Büros teilt mir freundlich, aber bestimmt mit, dass eine fünfprozentige Indexanpassung fällig wird. Basierend auf einem "VPI 2000", wie es im Kleingedruckten heißt. Es ist die x-te Erhöhung in kurzer Zeit. Gefühlt zahle ich mittlerweile das Doppelte dessen, was ich noch vor Corona für dieselben Räumlichkeiten bezahlt habe.
Diese Erfahrung ist kein Einzelfall. Sie ist symptomatisch für ein ökonomisches System, das wir als selbstverständlich hinnehmen, obwohl es zunehmend dysfunktional wirkt: Die Inflationsspirale, befeuert durch automatische Indexanpassungen.
Die Mechanik der Teuerungsspirale
Die Funktionsweise dieser Spirale ist perfide in ihrer Einfachheit: Die Inflation steigt, also erhöhen die Vermieter – gestützt auf Indexklauseln in Verträgen – die Mieten. Als Unternehmer muss ich diese Mehrkosten irgendwie auffangen. Da die Miete einen prozentualen Anteil X an meinen Gesamtkosten hat, muss ich meine Preise um Y Prozent erhöhen, um meinen Gewinn zu halten. Dasselbe gilt für alle anderen steigenden Kosten.
Indexklauseln treiben die Inflation an und zwingen Unternehmer wie Konsumenten in ein wirtschaftliches Hamsterrad.
Meine Kunden wiederum stehen vor der Entscheidung: Akzeptieren sie die höheren Preise oder verzichten sie auf meine Dienstleistungen? Anders als ich gegenüber meinem Vermieter haben sie immerhin diese Wahl. Im Gegensatz zum Immobilienmarkt, wo meine einzige Alternative wäre, das Büro zu kündigen und... ja was eigentlich? In Zeiten allgemeiner Mietsteigerungen anderswo noch teurer neu anzumieten?
Wer trägt letztlich die Last?
Folgen wir der Spur des Geldes, landen wir immer beim selben Ergebnis: Am Ende zahlen die Konsumentinnen und Konsumenten die Zeche. Nicht "die armen Unternehmer" oder "die öffentliche Hand" – das sind Mythen. Die öffentliche Hand sind wir alle als Steuerzahler. Und Unternehmen geben Kostensteigerungen grundsätzlich weiter, wenn der Markt es zulässt.
Diese Weitergabe befeuert die Inflation zusätzlich. Denn wenn alles teurer wird, brauchen die Menschen höhere Löhne, um ihren Lebensstandard zu halten. Höhere Löhne bedeuten für Unternehmen höhere Kosten, die wieder in Preiserhöhungen münden. Ein perfektes Hamsterrad.
Besonders problematisch: Dieses System wirkt wie ein Verstärker der Ungleichheit. Während kleine Unternehmen und vor allem die EPUs am Existenzminimum und Haushalte mit niedrigen Einkommen unter der Inflation leiden, profitieren jene, die Vermögenswerte besitzen – allen voran Immobilien. Die sogenannten "Wale" des Wirtschaftssystems leben davon, dass Preise steigen und Kapital automatisch zu mehr Kapital wird.
Die Reichen werden reicher, während die Mittelschicht um ihren Status kämpft und die Ärmsten noch weiter abgehängt werden. Ein Mechanismus, der in seiner Konsequenz die gesellschaftliche Stabilität gefährdet.
Wo bleibt die politische Verantwortung?
Als Gesellschaft haben wir eine Regierung gewählt, die die verdammte Pflicht hätte, für alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu sorgen – nicht nur für jene mit Vermögen und Lobbyisten.
Konkret bedeutet das: Die Politik muss die ungezügelte Inflation eindämmen. Eine Mietpreisbremse nicht nur für private Wohnungen, sondern auch für Gewerbeimmobilien wäre ein erster Schritt. Automatische Indexanpassungen gehören reguliert oder im Extremfall ausgesetzt, wenn sie die wirtschaftliche Existenz von KMUs und Haushalten gefährden.
Die Kurzsichtigkeit vieler Politikerinnen und Politiker ist frappierend. Während sie dem Druck von Lobbyisten nachgeben, die sicherstellen wollen, dass Kapital weiterhin zu Kapital fließt, übersehen sie die langfristigen Folgen: Eine ausgehöhlte Mittelschicht, steigende Unzufriedenheit und letztlich politische Instabilität.
Zeit für einen systemischen Neustart
Was wir brauchen, ist ein fundamentales Umdenken im Umgang mit Inflation. Automatismen wie Indexklauseln mögen in Zeiten moderater Teuerungsraten möglich sein – in Phasen hoher Inflation werden sie zu Brandbeschleunigern.
Die Inflationsspirale offenbart jedoch ein tieferliegendes Problem: Unser Wirtschaftssystem schützt systematisch Vermögenswerte und Kapital, während es die existenzielle Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dem Markt überlässt. Während Indexklauseln Vermieter vor Wertverlust schützen, gibt es keinen vergleichbaren automatischen Schutz für die Kaufkraft der Bevölkerung.
Diese Schieflage führt zu einer grundsätzlichen Frage: Sollten wir nicht die Prioritäten umkehren? Statt primär Vermögenswerte zu schützen, könnten wir die wirtschaftliche Existenz der Menschen absichern – durch die Verankerung ökonomischer Bürgerrechte in der Verfassung. Diese würden bedeuten, dass der Staat verfassungsrechtlich garantiert, die Existenz seiner Bürgerinnen und Bürger zu sichern. Es wäre das fundamentale Recht jedes Bürgers, dass seine Institution – der Staat – dafür sorgt, dass ökonomische Verwerfungen wie Inflationskrisen nicht seine Existenz gefährden.
Eine konkrete Implementierung dieser ökonomischen Bürgerrechte wäre ein System, das viele als bedingungsloses Grundeinkommen kennen. In Zeiten wie diesen, wo Inflation die Lebenshaltungskosten in die Höhe treibt, würde ein dynamisches Grundeinkommen als automatischer Stabilisator wirken – ähnlich wie Indexklauseln für Vermieter, nur eben für alle Bürgerinnen und Bürger. Es würde einen Mindestschutz bieten, der verhindert, dass Menschen allein durch Inflation unter die Armutsgrenze rutschen.
Die Geldtransaktionssteuer: Ein Weg aus der Inflationsfalle
Wie könnte man ein solches System finanzieren, ohne die Inflationsspirale weiter anzuheizen? Eine vielversprechende Lösung wäre die Geldtransaktionssteuer (GTS) – ein umfassender Ansatz für eine moderne und digitale Steuerreform. Im Gegensatz zu klassischen Umverteilungsmaßnahmen, die oft inflationär wirken, würde diese Steuer bei jeder finanziellen Transaktion einen minimalen Prozentsatz erheben, typischerweise um 1%.
Die GTS würde universell auf alle Arten von Geldtransaktionen angewendet werden – von bargeldlosen Überweisungen bis hin zu Bargeldgeschäften (durch die Registrierkassenpflicht heute leicht erfassbar), von Banktransaktionen bis hin zu Börsengeschäften. Trotz des niedrigen Steuersatzes würde die breite Bemessungsgrundlage erhebliche Steuereinnahmen generieren.
Ein besonderer Vorteil: Die GTS könnte die meisten bestehenden Steuern ersetzen, darunter Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer und Unternehmenssteuer. Dies würde nicht nur zu einer drastischen Vereinfachung des Steuersystems führen, sondern auch die administrativen Kosten für Steuerverwaltung erheblich senken.
Im Kontext der Inflation bietet die GTS mehrere Vorteile: Sie würde die Steuerlast gerechter verteilen, spekulative Aktivitäten auf den Finanzmärkten eindämmen (die oft inflationstreibend wirken) und durch ihre Automatisierung Steuervermeidung erschweren. Der Steuersatz könnte zudem dynamisch angepasst werden, um auf wirtschaftliche Schwankungen zu reagieren und ein ausgeglichenes Staatsbudget zu gewährleisten.
Die Echtzeiterhebung bei jeder Transaktion würde nicht nur Steuerhinterziehung minimieren, sondern auch die Möglichkeit bieten, soziale Programme wie ein bedingungsloses Grundeinkommen direkt zu finanzieren – ein wirksames Instrument gegen die sozialen Verwerfungen, die Inflation verursacht.
In der Zwischenzeit, während wir auf solche grundlegenden Reformen hinarbeiten, brauchen wir natürlich akute Maßnahmen gegen die Inflationsspirale: Temporäre Preis- und Mietdeckel nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen, Anti-Wucher-Gesetze und eine Geldpolitik, die nicht nur die Interessen der Vermögenden im Blick hat.
Dies alles wäre keine planwirtschaftliche Fantasie, sondern verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik in einer Zeit, in der die unsichtbare Hand des Marktes offensichtlich versagt. Letztlich geht es um einen neuen Gesellschaftsvertrag, der wirtschaftliche Stabilität nicht nur für Vermögende, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger garantiert.
Bis ein solches System Realität wird, bleibt mir als Unternehmer nur, die nächste Indexanpassung zu akzeptieren und meine eigenen Preise anzuheben – wohl wissend, dass ich damit Teil jenes Hamsterrads bin, das die Inflation weiter antreibt. Ein Teufelskreis, aus dem wir nur gemeinsam ausbrechen können, wenn wir bereit sind, unser Wirtschaftssystem nicht nur an den Symptomen zu kurieren, sondern strukturell zu reformieren.
Michael Kainz ist Gründer der DigitalWorld Academy und The Digioneer. Seine Kommentare zur Digitalisierung und ihren wirtschaftlichen Auswirkungen erscheinen regelmäßig in diesem Medium.
Weitere ausführliche Analysen zur Geldtransaktionssteuer und ökonomischen Bürgerrechten findest du in unseren früheren Beiträgen hier im Digioneer.
 The DigioneerMichael Kainz
The DigioneerMichael Kainz
 The DigioneerPhil Roosen
The DigioneerPhil Roosen